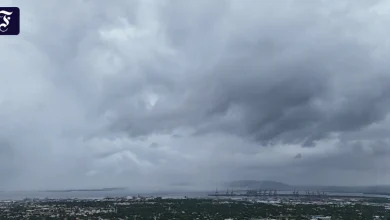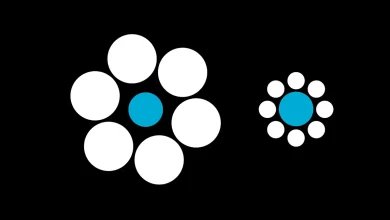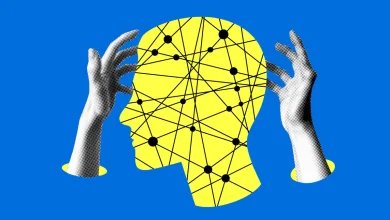Auf der Kuhweide: Wie Tiere uns glücklich machen können | ABC-Z

Woran erkennt man eine glückliche Kuh? Yvonne Meyer-Lohr steht hinter einem Weidezaun, bürstet ihre, die auf den Namen Madeleine hört, und sagt: „Schaut ihr in die Augen.“ Madeleines Blick wirkt klar, entspannt. Dann steigt Meyer-Lohr leicht breitbeinig und zugleich so geübt wie jemand, der das jeden Tag macht, über den elektrischen Zaun auf die andere Seite der Wiese, greift in ihre Tasche im Gras und zückt ihr Handy. Darauf zu sehen sind Bilder von Alma und Amalia, die gerade noch auf der Krankenstation verweilen.
Vergangene Woche wurden beide an den Klauen operiert. Wenn man ihnen in die Augen schaut, dann erinnert ihr Blick auf den Handyfotos an den von kranken Menschen: trüb, müde, traurig. Dabei sind Alma und Amalia doch eigentlich auch glückliche Kühe, nur eben jetzt in diesem Moment nicht, da sie sich noch erholen müssen.
„Ich wollte nie Kinder, jetzt habe ich sieben Rinder“
Madeleine, Alma und Amalia. Und Anni, Leni, Amanda und, als einziger kastrierter Bulle dazwischen, Leo. Die glücklichen Sieben, wie Yvonne Meyer-Lohr sie nennt, und damit sind sie in jeder Hinsicht eine Minderheit unter ihresgleichen in Deutschland. Sie tragen hübsche Vornamen statt anonyme Stallnummern. Zumindest die ersten vier von ihnen, Madeleine, Amanda, Leni und Leo, grasen an diesem Tag im Spätsommer schon auf der grünen Wiese, statt in einem Stall zu stehen. Und sie erwartet jetzt der Ruhestand, nicht der Schlachthof.
Denn die glücklichen Sieben haben Yvonne Meyer-Lohr. Die 57-Jährige sagt: „Ich wollte nie Kinder, jetzt habe ich sieben Rinder.“ Damit ist schon einiges über diese besondere Bindung erzählt, wie andere sie zu einem Hund verspüren, zu einer Katze, zu einem Pferd. Aber zu Kühen?
Eine Kuh ist gewiss kein Hund, der heute zunehmend Platz im Menschenleben bekommt: Der Hund darf entweder mit zur Arbeit kommen oder verbringt den Tag für viel Geld in einer Hundetagesstätte. Hotels stellen sich auf die Bedürfnisse des Hundes auf Reisen ein. Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln stehen bereit, um das Wohlbefinden des Hundes von innen zu stärken.
Als ob sie die Kuh ablecken würde
Selbst wenn sich auch der Blick auf Nutztiere verändert – wohl kaum jemand ist noch einverstanden mit der Massentierhaltung –, ändert das an den Lebensbedingungen der Kuh meist nicht viel. Sicher, da ist die Behauptung von glücklichen Kühen, wenn wir Joghurt oder Eis essen, das teurer als gewöhnlich ist und aus sogenannten Manufakturbetrieben stammt. Es ist nur leider nicht mehr als ein netter Gedanke. Yvonne Meyer-Lohr wird gleich darauf zu sprechen kommen. Gerade bürstet sie Madeleine mit deren Lieblingsbürste. „Das liebt sie. Das harte Bürsten imitiert die raue Kuhzunge“, sagt Meyer-Lohr. „Für Madeleine fühlt sich das an, als ob ich sie ablecken würde. Ich stärke jetzt meine Bindung zu ihr und zeige ihr meine Liebe.“
Mehrmals an diesem sonnigen Spätsommertag spricht Yvonne Meyer-Lohr aus, was man angesichts einer solchen Szene denken kann: „Das ist irre, ich weiß.“ Irre nicht nur, weil da eine Frau, die gar nicht landwirtschaftlich ausgebildet ist, sondern als Grafikdesignerin in Düsseldorf arbeitet, einer Kuh etwas Gutes tut. Irre auch, weil die Kuh offenbar auch dem Menschen guttut. Also mehr als Milch und Fleisch liefert. Sie kann glücklich machen.
„Sie hat meine Tränen ganz vorsichtig abgetupft“
Zumindest ist es bei Yvonne Meyer-Lohr so. Vor sechs Jahren stand sie am Zaun ihres Gartengrundstücks im Düsseldorfer Umland und war verzweifelt. Ihre beste Freundin, die zu diesem Zeitpunkt schon 92 war und sich in Folge eines Sturzes nicht mehr erholte, hatte sich dazu entschlossen, nichts mehr zu essen. Hungern, um zu sterben. Yvonne Meyer-Lohr weinte in diesem Sommer 2019 viel, und da kam auf einmal diese junge Kuh, 14 Monate alt, von der angrenzenden Weide an den Zaun. Meyer-Lohr erzählt, wie die Kuh ihr tief in die Augen schaute und dann ihre lange Zunge herausstreckte. „Sie hat meine Tränen ganz vorsichtig abgetupft, als würde sie diese mit einem Taschentuch trocknen.“ Die Kuh war da, um die Trauernde zu trösten.
Für sie war es an diesem Tag im Sommer die erste buchstäbliche Berührung mit einer Kuh. Bald darauf nannte sie das Tier, das so offensiv auf sie zugekommen war, Madeleine. Und sie gab auch allen anderen 21 Kühen auf der Weide Namen, Abigail, Blanche, Chantal, Chloé und so weiter. So ging das los.
Tiere und Natur hatte Yvonne Meyer-Lohr schon immer gemocht. Als Kind wünschte sie sich einen Hund, bekam ihn aber nie, dafür zwei Zwergpapageien. Mit ihren Eltern war sie im Terraristikverein aktiv: Baggerlöcher mit Unken und Fröschen besiedeln. Später, im Studium, war sie mit einem Fotografen liiert, der zwei Kater hatte. Auch zu diesen Tieren hatte sie ein enges Verhältnis. Nach der Trennung lebte sie ohne Tiere, und sie arbeitete viel.
Spätestens an diesem Punkt brach für Yvonne Meyer-Lohr das Design-Leben an: Designbüro, Werbeagentur, dann die Selbständigkeit. Selbst hier, auf der Kuhweide, ist ihr Bewusstsein für Ästhetik sichtbar. Das T-Shirt und die Leggings mögen alt sein, ganz in Schwarz, zur schwarzen kreisrunden Ray-Ban-Sonnenbrille ist das trotzdem ein Look. Ihre Wohnung hier im Grünen, fünf Minuten entfernt vom Gartengrundstück, ist so konsequent reduziert eingerichtet, als handelte es sich um ein Stadtapartment in Kyoto. Das Buch „Making Shoji“ über die Herstellung der berühmten japanischen Schiebetüren aus Holz liegt auf einem Stapel in der Ecke. Und in der Gartenlaube steht die Philippe-Starck-Saftpresse bereit, hinter der Tür eine Tüte vom Pariser Parfümeur Frédéric Malle.
„Und hier hängt dann der gesamte Wahnsinn“, sagt Yvonne Meyer-Lohr und deutet auf sechs Ausdrucke an der Laubenwand. Meyer-Lohr hat sie gestaltet. Auf jedem um die 20 Kuhköpfe jeweils mit weiteren wohlklingenden, häufig französischen Namen versehen, auf die ebenfalls sie kam. Die Kühe der vergangenen sechs Sommer auf der Weide nebenan. Sie betont, dass es reine Nettigkeit des Bauern sei, seinen Kühen jeweils einen Sommer an der frischen Luft zu bieten, bevor sie besamt und folglich in den Milchbetrieb eingegliedert werden – und für unsere Augen verschwinden.
Auch Meyer-Lohr unterliegt der „Doppelmoral“
Denn unser Blick auf Kühe begrenzt sich in der Regel auf jene Tiere, die im Freien grasen. Für Erwachsene stehen sie wie Deko in der Landschaft, für Kinder sind sie eine schöne Abwechslung auf langen Autofahrten. „Da, schaut mal, Kühe!“ Yvonne Meyer-Lohr kennt nach mehr als sechs Jahren das Kuhleben fernab der Weide. Sie weiß, dass nur ein geringer Anteil Zugang zu einer Weide hat, dass es im Stall laut ist und nach Gülle und Mist stinkt, was für Rinder, die eine feine Nase haben, besonders schlimm sein muss. „Ruhe und Zeit, die gibt es im Stall nicht“, sagt sie. Und auch Kühe haben Vorlieben. Sie mögen zum Beispiel die eine Kuh gerne und eine andere überhaupt nicht. Auf der Weide gebe es auch Abneigungen, klar, aber da könne man sich aus dem Weg gehen. „Das ist der natürliche Lebensraum von Rindern. Dort haben sie Platz, und der Boden ist, anders als im Stall, weich, was wiederum wichtig für gesunde Klauen ist.“
Nach dem Kennenlernen mit den Kühen auf der Weide im Sommer 2019 kam sie regelmäßig, um nach ihnen zu schauen. Dann war sie bei den Geburten von deren Kälbern dabei. Und bei den Operationen, wenn sie, wie Madeleine, Probleme mit den Klauen bekamen. Sie erfuhr, wie so eine Erkrankung eigentlich das Schicksal eines Kuhlebens besiegelt. Denn die teure OP ist in einem System, in dem Kosten und Nutzen genau aufgerechnet werden müssen, für gewöhnlich nicht vorgesehen.

So kam Yvonne Meyer-Lohr auf die Idee, dem Landwirt erst Madeleine und dann nach und nach mehr Tiere abzukaufen. Um ihnen einen schönen Lebensabend zu bereiten. Bei einem Bauern in der Nähe fand sie ein Stück Weide für den Sommer mit einem Stall für den Winter und der Option auf Auslauf, wenn es zwischen November und März nur lang genug trocken ist.
Sie ist mit den Kühen jetzt nicht mehr nur befreundet, sondern auch für sie verantwortlich. „Früher war das hier Entspannung“, sagt sie und kniet im Gras am Rand der Kuhweide. „Jetzt entspanne ich mich in Düsseldorf am Rechner.“ Wenn sie bei den Tieren ankommt, dann geht es jetzt nicht allein um die Freude, die beide Seiten aneinander haben. „Ich prüfe: Haben sie warme Ohren? Das ist ein Zeichen für Gesundheit. Humpelt jemand? Ist sonst etwas untypisch?“ Und an diesem Tag im Spätsommer: „Wird es morgen zu heiß sein? Ab 15 Grad bekommen Kühe Hitzestress“, sagt Meyer-Lohr. Regen und Kälte machen ihnen hingegen gar nichts. Sie schneidet jetzt vier Kilogramm Möhren in Stücke. „Kleiner Snack“, sagt sie. Und dann, an ihre Kuh gerichtet: „Nein, Madeleine, du hattest schon zwei Bananen.“ Mehr soll eine Kuh am Tag nicht bekommen.
Kann sie sich angesichts dieser Bindung zu sieben offenbar glücklichen Kühen noch Frischkäse aus dem Kühlregal aufs Brot streichen? Der aus der Milch von sicher deutlich weniger privilegierten Kühen gemacht ist? „Ich kaufe Bergkäse aus der Schweiz oder Ziegenkäse“, sagt Meyer-Lohr. „Aber der Doppelmoral unterliege ich natürlich trotzdem.“ Selbst wenn sie sich die Milch von dem Bauern holt, bei dem ihre sieben Kühe die ersten Lebensjahre verbracht haben, greift sie eben auch mal im Supermarkt beim Joghurt zu. Sie ist Vegetarierin, nicht Veganerin. Als Konsumentin, sagt Meyer-Lohr, sei man im Alltag verloren. Weidemilch zum Beispiel muss noch nichts bedeuten, der Begriff ist rechtlich nicht geschützt, Heumilch hingegen ist es schon, gibt aber nur Auskunft über das Futter, nicht die Haltung. Auch die Haltungsformkennzeichnung, wie sie zum Beispiel bei Eiern seit mehr als 20 Jahren verpflichtend ist, taucht auf Milchprodukten noch nicht wie selbstverständlich auf, dabei wäre es ein Hinweis an den Verbraucher.
Für den Weidegang braucht es Land
Auch Siegel, so bestätigen es Branchenexperten, seien Anhaltspunkte. „Pro Weideland“ zum Beispiel garantiert einen Weidegang für sechs Stunden an 120 Tagen im Jahr. Stufe 2 des Siegels „Für mehr Tierschutz“ umfasst ebenfalls Auslauf und Freilandhaltung. Auch für Demeter-, Bioland- und Naturland-Siegel braucht es Zugang zu Weideflächen. Das EU-Biosiegel hingegen verlangt diesen Zugang nur, „wann immer Umstände dies gestatten“.
Zu den außerdem vertrauenswürdigen Siegeln zählten gemäß Experten das QMilch-Siegel und das DLG-Tierwohl-Siegel. Weidegang umfasst ersteres in der Kategorie „QM+++“, zweiteres in der Kategorie Gold.

Aber für den Weidegang braucht es das Land, und das müssen landwirtschaftliche Betriebe heute oft anders nutzen, eben wirtschaftlicher, um überhaupt zu überleben. Yvonne Meyer-Lohr möchte nicht negativ über die konventionelle Landwirtschaft sprechen. Nach sechs Jahren kennt sie beide Seiten. „Für die Tiere ist es furchtbar, aber ich verstehe das Dilemma dermaßen.“ Bei einem aktuellen Milchpreis von knapp 50 Cent pro Liter Milch, die der Landwirt erhält, ist schlicht keine Zeit, um jedem Tier individuell zu begegnen. Zugleich ist aber jedes Tier genau das: ein Lebewesen mit individuellen Bedürfnissen. „Die Amalia zum Beispiel, die möchte auf gar keinen Fall am Kopf gestreichelt werden. Ihre Mutter hingegen, Amanda, reckt immer den Kopf hoch, als würde sie rufen: Bitte komm und bürste mich!“ Jede Kuh ist anders.
Madeleine – und den anderen sechs Kühen – steht, wenn es gut läuft, noch ein langes Leben bevor. Die Lebenserwartung einer Kuh liegt bei 20 bis 25 Jahren. Meyer-Lohr rechnet mit 1000 Euro pro Wintermonat für Kost und Logis der kleinen Herde. Im Sommer, während der Weidesaison, ist es weniger. „Ich wusste nie, wofür ich mein erspartes Geld einmal ausgeben würde. Jetzt weiß ich es.“ Da ist es wieder, das Glücks-Argument: „Wenn ich hier bin, spüre ich, dass mein Blick sich entspannt und der Stress von mir abfällt.“ Die Frau, die sich auch an schönen Produkten erfreuen kann, sagt: „Kein richtig toller teurer Designermantel macht mir so viel Freude. Da habe ich nach einer Weile das Gefühl, es müsste mal etwas Neues her. Das ist hier anders. An diesen Tieren verliere ich nie die Freude.“
Es bricht ihr das Herz
Meyer-Lohr weiß, dass ihr Glück kostbar ist. Denn auch sie musste bei sieben Tieren die Grenze ziehen. „Ich weiß, ich kann nicht alle retten, und das bricht mir das Herz.“ Sie versteht das System, und es macht sie zugleich traurig. „Da ist zum Beispiel Daphne.“ Eine Freundin von Madeleine. „Sie hat dem Bauern sechs Mutterkälber geboren. Sollte sie irgendwann krank oder nicht mehr tragend werden, dann bleibt für sie nur die Fahrt zum Schlachthof. Warum können unsere Landwirte einem Tier, das über so lange Zeit gut für ihren Betrieb gearbeitet hat, nicht noch zwei Jahre auf einer Weide ermöglichen? Das sieht unser System leider nicht vor.“
Aber Meyer-Lohr kann nicht auch noch Daphne übernehmen. „Was ist dann mit Annis bester Freundin Helene? Und Amalias bester Freundin Erwine? Das wird uferlos. Ich muss so hart bleiben.“ Das Dilemma der Landwirte ist am Ende auch das Dilemma von Meyer-Lohr. Aber immerhin hat sie diese sieben Kühe, und diese sieben Kühe haben sie.
Als Meyer-Lohr den Besuch zu ihrem Auto auf der anderen Seite der Straße bringt, kommen Madeleine, Amanda, Leni und Leo angelaufen. Die Tiere, die irgendwann an diesem Vormittag das Interesse an menschlicher Gesellschaft auf der Wiese verloren haben und sich stattdessen lieber an Baumstämmen schubberten und grasten, recken jetzt ihre Hälse über den Zaun. Auf dem Aufnahmegerät, das währenddessen läuft, ist später ein lautes Rascheln zu hören: das Schnauben der Kühe, das – so viel ist nach dem Vormittag hier klar – mehr ist als das. Es könnte bedeuten: Bitte nicht gehen! „Mausi“, sagt Meyer-Lohr und streichelt Madeleine den Kopf. „Ich komme gleich wieder.“ Wieder Rascheln. „Ihr Süßen“, sagt sie jetzt zu allen Tieren, „lauft mal in den Schatten. Ich bin gleich wieder da, und dann kuscheln wir.“