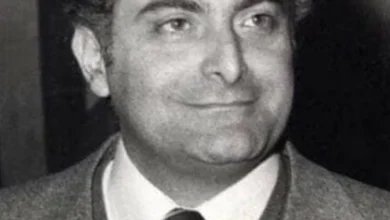Die vielen Probleme der Lufthansa – von den Piloten bis zur Verwaltung | ABC-Z

Der Schein kann trügen. Die Deutsche Lufthansa hat sich zum größten Flugkonzern der Welt gemausert, der nicht in den USA sitzt. Und im vergangenen Jahr wurde ein stattlicher Überschuss von 1,4 Milliarden Euro eingeflogen. Klingt blendend. Doch die Konzernkeimzelle, der Betrieb der Flugzeuge mit dem Lufthansa-Kranich am Heck, fliegt defizitär.
Die direkten Wettbewerber unter den Netzwerk-Airlines, Air France-KLM sowie British Airways und Iberia aus dem IAG-Konzern, melden solide Margen. Im Fall von IAG übertreffen die schon jetzt deutlich das Ziel, das Lufthansa erst in den kommenden Jahren erreichen will. Und die knapp 20 Prozent Kursplus für die Lufthansa-Aktie binnen eines Jahres verblassen angesichts deutlich stärkerer Entwicklungen der Wettbewerberpapiere. Investoren dämmerte also schon länger, dass der Lufthansa-Konzern nicht arm an Baustellen ist.
Nun sendet der Konzern eine Schockwelle. Tausende Stellen fallen weg, nicht bei Piloten und Flugbegleitern, sondern in den Verwaltungsetagen am Boden. Dort wird jeder fünfte Arbeitsplatz gestrichen. So sollen Kosten sinken, um die Position in der Führungsgruppe der Airlines der Welt halten zu können. Es werden Doppelstrukturen abgebaut. Alles soll schlanker werden, damit Vorhaben schneller zum Ziel kommen – in einem Konzern, der sich auch gern mit sich selbst beschäftigt hat. Den Mitarbeitern allein kann man diesen Missstand schwerlich vorwerfen, er wurde über sehr lange Zeit gepflegt.
Probleme von außen und von innen
Lufthansa hat mit einem ganzen Strauß an Problemen zu kämpfen, einige kamen von außen, andere sind hausgemacht. In der Kombination sind sie zur Last geworden. Von außen kommt, dass in Deutschland der Staat bei Steuern und Gebühren derart draufsattelte, dass für den Start eines A320-Flugzeugs mit 150 Passagieren an Bord in Frankfurt nun 83 Prozent mehr abzuführen sind als im Vor-Corona-Jahr 2019. Die Abgaben summieren sich auf fast das Zweieinhalbfache des Vergleichswerts in Rom und gar auf das Siebenfache der Abgabenlast für Starts in Madrid. Da wird es schwer, bei den Margen mit anderen Fluggesellschaften mitzuhalten.
Doch die Verantwortung für knappe – und bei der Kernmarke Lufthansa fehlende – Gewinne allein dem Staat zuzuschieben, wäre falsch. Lufthansa hat über Jahre Fett angesetzt, sich hohe Gehälter und eine große Verwaltung geleistet. Dennoch gestaltete sich die Entwicklung von neuem Mobiliar für die Langstreckenflotte teuer und von Verzögerungen geprägt. Noch einige Zeit muss die Mehrheit der Passagiere mit Sitzen vorliebnehmen, die älter sind als das Gestühl der Konkurrenz.
Hinzu kommt, dass auch Flugzeuge in die Jahre gekommen sind. Sie verbrauchen mehr Kerosin als jüngere Modelle und sind im Betrieb teurer. Der Ersatz lässt auf sich warten, weil Flugzeughersteller stark verzögert liefern. Lufthansa hatte allerdings auch spät bestellt. Und als der Hochlauf des Betriebs nach der Pandemie besonders holprig lief, wirkte der Konzern über sich selbst erschrocken, dass ausgerechnet der deutsche Anbieter mit Premiumanspruch patzte – als wenn dies ausgeschlossen wäre und jenseits des Vorstellbaren lag. Die Gegenmaßnahmen dauerten und gerieten teuer. Immerhin ist die Pünktlichkeit auf einem Elf-Jahres-Hoch, das Ergebnis der Kernmarke ist meilenweit davon entfernt.
Mehr Bündelung ist nötig
Durch Übernahmen ist der Konzern außerdem zu einem Sammelsurium an Marken geworden. Stolz verkündete man immer wieder, dass die Zukäufe die Identität ihres Herkunftslandes behalten dürfen und nicht aus schnöden betriebswirtschaftlichen Erwägungen ihrer Seele beraubt werden. Das sollte auch gut Wetter bei Regierungen machen, die zwar einen starken Partner für darbende Airlines suchten, aber auch keine Eindeutschung von Traditionsmarken ihrer Länder wollten. Zuletzt überzeugte der Konzern in Italien beim Griff nach ITA mit dieser Strategie.
Doch dem Vorstand um Carsten Spohr ist nicht entgangen, dass die gepriesene Vielfalt für Komplexität sorgt. Dass mehr Entscheidungen zentralisiert werden sollen, hat Lufthansa schon bekannt gegeben. Mit der wohlklingenden Formel, aus einer Gruppe von Airlines forme man nun eine Airline-Gruppe, kündigte man einerseits einen Umbau an und sandte andererseits die Botschaft, dass sich eigentlich gar nicht viel ändern werde. Die Verwaltungsbeschäftigten, die bald jeden fünften Kollegen nicht mehr an ihrer Seite haben werden, dürften darüber anders denken.
Immerhin soll der Abbau sozialverträglich, möglichst ohne Kündigungen, erfolgen. Und nötig ist der Schritt zur Kostensenkung auch. Wenn nicht mehr jede einzelne Tochtergesellschaft für sich über Flugverbindungen und deren Preise entscheidet, braucht der Konzern weniger Personal.
Erklärungsnöte und ein Gefühl der Ungerechtigkeit
Der Umbau führt aber auch zu der argumentativen Herausforderung, wie Lufthansa vor der nächsten Übernahme mit der Bewahrung nationaler Identitäten werben will. Der Regierung Portugals, der sich Lufthansa als Partner für die Privatisierung der Gesellschaft TAP andient, werden die Vorgänge in Frankfurt nicht verborgen bleiben.
Auch innerhalb der heutigen Konzerngrenzen wird es nun spannend. Die Piloten der Kernmarke Lufthansa spielen eine Rolle dabei. Bei ihnen hat sich Unmut aufgestaut, weshalb die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit den Tarifkonflikt über eine höhere betriebliche Altersvorsorge bis zur Abstimmung über Streiks eskaliert hat. Nun fordert eine Berufsgruppe, nämlich in den Cockpits, kämpferisch mehr Geld, während eine andere, nämlich in den Büros am Boden, zum Aderlass zitiert wird.
Und auch bei profitablen Betrieben wie Swiss in der Schweiz kursiert die Frage, warum ihnen Verantwortlichkeiten genommen werden, wenn insbesondere der deutsche Konzernkern, der schon ein Turnaround-Programm durchläuft, der Underperformer ist. Das erscheint ungerecht. Für Investoren mag es zunächst wohltuend klingen, dass die Konzernführung um Carsten Spohr Entscheidungen über Spar- und Umbauprogramme getroffen hat, um bei Margen zu den Wettbewerbern aufzuschließen. Ausstehend ist nun aber die nicht minder schwere Aufgabe, im Konzern die Wogen wieder zu glätten. Denn dort ist die Unruhe gerade noch gewachsen.