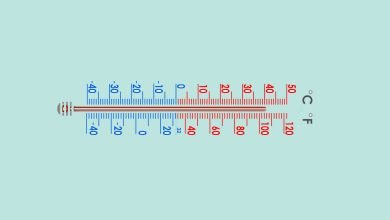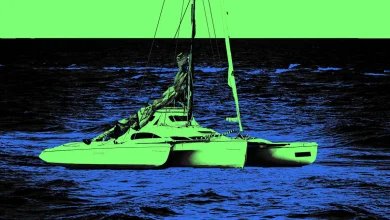Die globale Finanzordnung wird politisiert | ABC-Z

Nach drei Jahrzehnten neoliberaler Finanzglobalisierung befinden sich die Finanzmärkte im Übergang zu einer neuen Phase, in der Kapitalflüsse, Regeln und Risiken globaler Finanzbeziehungen politisch neu bestimmt werden. Sanktionen, Zahlungssysteme, Währungsreserven und Börsennotierungen dienen zunehmend als Hebel der Außen- und Sicherheitspolitik. Globalisierung wird dadurch nicht beendet, sondern neu konfiguriert. Mit anderen Worten: Wir erleben gerade die geoökonomische Wende der globalen Finanzordnung.
Washington nutzt die Dollarordnung zunehmend als Machtinstrument. Sanktionen, SWIFT-Ausschlüsse und Investmentscreenings werden für geopolitische Ziele eingesetzt. Gegenüber China etwa verschärft die Regierung den Druck, was am Aktienmarkt besonders sichtbar wird: 2014 symbolisierte Alibabas Rekord-Börsengang in New York noch den Glauben an grenzenlose Finanzintegration – heute bestimmen Delistings, verschärfte Offenlegungspflichten und politisierte Schlagzeilen die Beziehungen an den Kapitalmärkten. Anhörungen im US-Kongress setzen Banken und Investoren unter Druck, ihre Chinageschäfte zu rechtfertigen, und manche US-Fonds spalten ihre Portfolios bereits auf. Bilanz- und Kreditrisiken sind nicht länger ökonomisch, sondern geopolitisch. Andere Staaten wie Russland, Iran oder Venezuela sind ebenfalls Ziel solcher oder gar drastischerer Maßnahmen.
Die Antwort vieler Staaten – sowohl betroffener als auch anderer, die nicht der zunehmenden Willkür des Hegemonen ausgesetzt sein wollen – ist der Versuch, sich vom Dollar zu lösen. Während im Jahr 2008 US-Staatsanleihen („treasuries“) noch zu 56 Prozent von ausländischen Investoren – insbesondere Zentralbanken – gehalten wurden, liegt dieser Wert heute nur noch bei 30 Prozent. Zeitgleich ist der Anteil von Gold, dem ultimativ sicheren Anlagehafen, in globalen Währungsreserven von elf auf 23 Prozent angewachsen. Der Weg der Entdollarisierung ist schwierig, und Alternativen sind begrenzt. Dennoch überwiegen zunehmend politische Argumente die Effizienzlogik des bestehenden Systems.
Durch den Aufbau alternativer Finanzinfrastrukturen gewinnt der Renminbi an Boden, vorwiegend im globalen Süden, während regionale Währungssysteme in der Karibik, Afrika oder am Golf Redundanzen schaffen. Das Ergebnis ist keine Ablösung, sondern eine Fragmentierung: Der Dollar bleibt (vorerst) Leitwährung, doch Alternativen mindern Verwundbarkeiten und verschieben Kräfteverhältnisse. US-Hegemonie wird nicht abgelöst, aber relativiert.
Neue Finanzzentren, bilaterale Währungskooperationen und regionale Finanzräume schaffen eine fragmentiertere Architektur. Nicht nur China, auch die Golfstaaten, Indien oder Brasilien entwickeln Alternativen und neue Partnerschaften entstehen, die zunehmend Finanzflüsse verlagern. Für private Akteure verändert sich damit das Spielfeld grundlegend: Indexanbieter, Ratingagenturen, Investmentbanken und Asset-Manager sind nicht länger „Masters of the Universe“, sondern haftende Intermediäre, die zwischen Profitinteressen, US-Recht, EU-Vorgaben und chinesischer Regulatorik manövrieren müssen. Die Folge: mehr Sicherheiten, höhere Kosten, zerstückelte Preisbildung – und spürbar mehr Reibung im Alltag globaler Finanzströme.
Aufbau europäischer Alternativen als Aufgabe
Europa und Deutschland sind in der neuen geoökonomischen Finanzordnung verletzlich, weil sie lange auf offene Märkte vertraut haben. Heute zählen Resilienz, Koordination und staatliche Handlungsfähigkeit. De-Risking allein reicht dafür nicht aus. Die eigentliche Aufgabe ist der Aufbau europäischer Alternativen: im Zahlungsverkehr, in der Verwahrung von Vermögenswerten sowie bei Finanz- und Dateninfrastrukturen. Nur so lässt sich echte Autonomie schaffen.
Das verlangt mehr als nationale Strategien: Gefragt sind gemeinsame europäische Lösungen, die den Euro international stärken, Abhängigkeiten systematisch verringern und Europas Abwehrfähigkeit gegen ökonomischen Druck von außen sichern. Für Deutschland heißt das, nationale Maßnahmen in ein europäisches Gesamtkonzept einzubetten. Nicht Rückzug, sondern der Aufbau gemeinsamer Kapazitäten sichert Handlungsfähigkeit in einer zunehmend fragmentierten Finanzwelt.
Dr. Johannes Petry
Johannes Petry ist Politökonom an der Goethe Universität Frankfurt sowie der Leiter des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten „StateCapFinance“ Forschungsprojekts. Gerade erschien sein neues Buch „BRICS and the Global Financial Order“ gemeinsam mit Andreas Nölke.
Bild: Privat