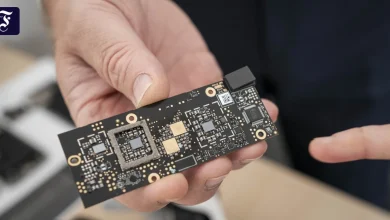Die Düsseldorfer Schau „Künstlerinnen! Von Monjé bis Münter“ | ABC-Z

Da wäre zum Beispiel Emilie Preyer, die 1849 in Düsseldorf geborene Tochter eines Stilllebenmalers: Ihr ebnete die Herkunft aus einer Künstlerfamilie den Lebensweg als professionelle Malerin, der zahllosen anderen Frauen ihrer Generation versperrt blieb. Vielleicht gab der Vater Johann Wilhelm Preyer, seiner Kleinwüchsigkeit wegen von Zeitgenossen als „Malerzwerg“ tituliert, auch weniger auf gesellschaftliche Normvorstellungen davon, wer was werden könne, als Durchschnittsmenschen seiner Epoche. Auf jeden Fall unterrichtete er die Tochter wie den Sohn in seinem Atelier, woraufhin Emilie sogar als inoffizielle Studentin an der Königlichen Kunstakademie in Düsseldorf zugelassen wurde, die damals regulär nur Männer aufnahm.
Dem Vater ebenbürtig
Ihnen zeigte sich die junge Künstlerin rasch so ebenbürtig wie dem Vater, nach dessen Vorbild sie sich auf die Fertigung von Früchtestillleben mit altmeisterlicher Finesse spezialisierte. Was von ihm stammt, was von ihr, ist oft nicht leicht zu unterscheiden. Doch Emilie Preyers mit glänzenden Tropfen besprengte Trauben, samtig gerundete Pfirsiche oder transparent schimmernde Gläser auf Tischtüchern oder Marmorplatten trifft ein charakteristisch weiches Licht von der Seite, und einzelne Fliegen oder Wespen im Bild markieren die Vergänglichkeit der organischen Pracht.
Für diese begeisterten sich mit wachsendem Erfolg der Malerin Sammler vor allem in Großbritannien und Amerika, und so ist es bis heute geblieben. Zwischen 25.000 und 55.000 Euro bewegen sich – bei leicht steigender Tendenz – Marktpreise für die kleinformatigen Arbeiten der 1930 verstorbenen Künstlerin, die nie heiratete, nie aus Düsseldorf fortzog, nie daran dachte, Spuren der Moderne in ihren Reminiszenzen des siebzehnten Jahrhunderts zuzulassen, nie als Weltsensation gehandelt wurde, aber auch nie in Vergessenheit geriet als Meisterin des von ihr gewählten Fachs.
Zahlreiche andere der unter dem Titel „Künstlerinnen!“ aufgerufenen Frauen des neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts, deren Schaffen der Kunstpalast in Düsseldorf nun mit einer bemerkenswerten Ausstellung würdigt, waren weniger begünstigt. Sie lernten, stellten aus, verkauften – und verschwanden aus dem kollektiven Gedächtnis. Um die zu Unrecht Vergessenen wieder in Erinnerung zu rufen, startete die Museumsstiftung vor vier Jahren ein Forschungsprojekt, das Künstlerinnen identifizieren sollte, die zwischen 1819 und 1919 in Düsseldorf tätig waren, die Privatunterricht nahmen, an den ihnen von 1870 an offenstehenden Kunstgewerbeschulen studierten oder selbständig arbeiteten. In den hundert Jahren zwischen der Wiedergründung der Kunstakademie und deren beginnender Öffnung für Frauen übte die Stadt als Ausbildungsort für weibliche Kunstschaffende bis nach Skandinavien große Anziehungskraft aus, die mit den aufkommenden Avantgarde-Bewegungen in Paris und München schwand. Das aktive Vergessen der Frauen setzte schon früher ein: parallel zu ihrer größer werdenden Präsenz im Kunstbetrieb. Heute würde man das „Backlash“ nennen.

Die Folgen stellt die Ausstellung selbstkritisch aus. Noch 1979 war in einer Überblicksausstellung zur Düsseldorfer Malerschule im damaligen Kunstmuseum der Stadt nur eine Künstlerin vertreten: die Finnin Fanny Churberg (1845 bis 1892) mit einem Landschaftsbild. Immer noch sind im Bestand des heutigen Museums Kunstpalast, das auf einen 1846 gegründeten Verein zurückgeht, der Werke vor allem der Düsseldorfer Malerschule für eine künftige Gemäldegalerie erwarb, Frauen unterrepräsentiert. Ankäufe seit 2017 sollen ebenso für einen allmählichen Ausgleich sorgen wie die aktuelle Schau. Sie steht im immer breiter gewordenen Strom feministischer Befragungen des Kanons, der in jüngerer Zeit Forschungseinrichtungen, Museen, Kunsthandel und den Sachbuchmarkt erfasst hat.
Mehr als fünfhundert Namen mit Düsseldorf verbundener Künstlerinnen konnten die Recherchen des Kunstpalastes unter der Leitung der dort für Kunst des neunzehnten Jahrhunderts zuständigen Kathrin DuBois ermitteln. Das sind fast dreihundert mehr, als bisher bekannt waren. Aus der Menge treten in der chronologisch aufgebauten Überblicksschau 31 Frauen, deren Werke beispielhaft für das weibliche Schaffen zwischen Romantik und Expressionismus im Rheinland stehen – für Grenzen, Möglichkeiten und Charakteristika.
Mehr als schmückendes Beiwerk
Weil auch Emanzipationsgeschichte nicht linear verläuft, hatten diese Frauen durchaus Vorläuferinnen und Wegbereiterinnen: Catharina Treu zum Beispiel, eine Stilllebenmalerin des Rokoko, die 1776 eine Professur an der Kunstakademie in Düsseldorf erhielt. Damals war das möglich. Frauen konnten darauf bauen, dass Kunstunterricht traditionell zum häuslichen Curriculum junger adliger Damen sowie höherer Bürgerstöchter gehörte, ebenso allerdings wie Nadelarbeiten oder andere dekorative Tätigkeiten. Insofern verbindet eine verschlungene Linie Catharina Treus Engagement als Hofmalerin mit den Interieurs und Landschaftsbildern, die um 1840 Wilhelmine Luise von Preußen mit Deckfarben malte, und den Arabesken für Gebet- und Sinnspruchbüchlein, mit denen sich Hermine Stilke in den 1830er-Jahren hervortat. Der Seitenweg zur angewandten Kunst, den etwa die Malerin Martel Schwichtenberg als Grafikerin für die Keksfabrik Bahlsen einschlug, ist hier schon angelegt.
Zuständig für das schmückende Ornament am Rande und selbst beinahe ein solches: Dass Künstlerinnen in Bereichen wirkten, die der traditionellen Gattungshierarchie zufolge weiter unten angesiedelt waren, ist Geschlechterstereotypen ebenso geschuldet wie dem mangelnden Zugang etwa zum Aktzeichnen – einer Voraussetzung für als ranghöher betrachtete komplexe Figurenkompositionen mit historischer, literarischer oder religiöser Thematik. Dass sich die Wertschätzung der Gattungen seither durchaus verschoben hat, kommt ihnen postum zugute.

Eine in Düsseldorf geschulte, weit gereiste Künstlerin, der es gelang, in großer Bandbreite und großen Formaten im neunzehnten Jahrhundert gefragte Kunst aufzubieten, ist Elisabeth Jerichau-Baumann (1819 bis 1881). Ihr bekanntestes Werk, ein Doppelbildnis der Gebrüder Grimm, fehlt zwar in der Ausstellung. Dafür ist eine Fülle anderer Gemälde zu sehen: ein Selbstbildnis, die orientalistische Darstellung einer ägyptischen Fellachin mit Säugling, eine in einer italienischen Schenke angesiedelte Genreszene, das patriotische Bild eines verwundeten dänischen Soldaten, die fast symbolistisch wirkende Vision einer Meerjungfrau und ein Bildnis des Ehemanns der Künstlerin, des dänischen Bildhauers Jens Adolf Jerichau.
Letzterer spielte sicherlich eine Schlüsselrolle für ihre Entwicklung. War der eigene Mann Künstler – oder Kunsthistoriker, wie der von Mathilde Dietrichson (1837 bis 1921) –, stiegen für Verheiratete die Chancen auf eine künstlerische Karriere. Adeline Jaeger (1809 bis 1897) erlebte das Gegenteil, als sie einen evangelischen Pastor heiratete und als Porträtmalerin – und Mutter von fünf Kindern – auf den familiären Kreis zurückgeworfen wurde.
Familie und Beruf: schwierig
Wie sich die Unvereinbarkeit von familiären Forderungen und künstlerischer Selbstverwirklichung in der Kaiserzeit aus männlicher Perspektive darstellte, führt August Friedrich Siegerts Gemälde „Die Fruchtmalerin“ von 1876 vor Augen: Da drängen kecke Kinder ins Atelier ihrer Mutter, die mit dem Malstock ein wenig Freiraum anmahnen mag, doch die Pinsel eigentlich weglegen kann. Der Blick in den privilegierten Haushalt – eine private Malausbildung für Frauen war teuer – ist weniger heiter, als er scheint. Wie anders setzte Jeanna Bauck ihre Freundin und Kollegin Bertha Wegmann 1889 beim Porträtieren ins Bild: Hier geht eine selbständige Unternehmerin zu Werke, und das Motiv ist die Tätigkeit, nicht die Frau an der Staffelei, die ihr nachgeht.

Wer offensichtliche Revolutionen in den Bildern der Ausstellung sucht, wird enttäuscht werden: Wollte ein Frau im langen neunzehnten Jahrhundert einen Platz im Kunstestablishment erobern, war es ratsam, dem „female gaze“ zum Trotz Erwartungen zu erfüllen. Und als höchstes Lob galt ein Ausruf wie der dem Akademiedirektor Peter Cornelius nachgesagte: Elisabeth Jerichau-Baumann sei der einzige Mann der Düsseldorfer Malerschule. Breitschultrig behauptete sich auch Paula Monjé (1844 bis 1919) mit ihren historistischen Großformaten im wilhelminischen Zeitgeschmack. Sie wusste sich in Kunstvereinen und medial zu vernetzen und pochte beim Direktor der Berliner Nationalgalerie Ludwig Justi auf Ausstellung eines ihrer Werke – allerdings vergeblich.
Die Farbexplosionen in den Gemälden Gabriele Münters (1877 bis 1962), mit denen die Ausstellung schließt, sind schon das Leuchten neuer Freiheiten für Frauen der Moderne: Nach Anfängen in einer Düsseldorfer Damenkunstschule fand die Malerin in München zu Wassily Kandinsky und zum „Blaue Reiter“-Expressionismus – natürlich zunächst eher als Anhängsel wahrgenommen. Die vollumfängliche Würdigung kam, wie für zahlreiche der im Kunstpalast nun erstmals seit mehr als hundert Jahren wieder öffentlich präsentierten Werke, spät. Aber nicht zu spät.
„Künstlerinnen! Von Monjé bis Münter“, Kunstpalast Düsseldorf, bis zum 1. Februar 2026. Der Katalog kostet 40 Euro.