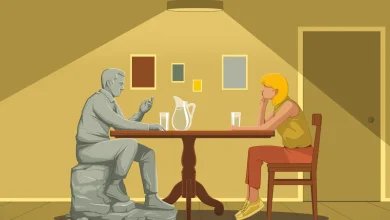Die Chance des Westens: Warum Chinas Monopol auf Seltene Erden bröckelt | ABC-Z

Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt: Mit diesen Worten, frei übersetzt, endete am 29. Mai 2019 ein Artikel in der Volkstageszeitung, dem wichtigsten Sprachrohr der Kommunistischen Partei Chinas. In dem Artikel ging es um die Abhängigkeit der USA von Chinas Seltenen Erden, vor allem in der Elektronik- und Verteidigungsindustrie. Wenige Tage zuvor hatte Chinas Präsident Xi Jinping eine Fabrik für die wertvollen Rohstoffe in der Provinz Jiangxi besucht und damit der Welt signalisiert: Wir sind bereit, diesen Trumpf zu spielen.
Im April dieses Jahres, als Donald Trump hohe Zölle auf chinesische Waren verhängte, spielte Xi diesen Trumpf zum ersten Mal aus. Im Oktober, als die US-Regierung ihre Sanktionen von 1000 chinesischen Unternehmen auf fast 20.000 ausweitete, spielte Xi ihn abermals aus. Und beim Treffen der beiden Staatschefs in Südkorea zeigte sich vergangene Woche, dass es der wohl mächtigste Trumpf im Handelskrieg ist.
Die westliche Industrie hängt am Tropf chinesischer Seltener Erden. Doch im Kartenspiel wie im Weltmachtpoker gilt: Wer seine Trümpfe einmal auf den Tisch gelegt hat, muss damit rechnen, dass die anderen Spieler sich eine Strategie überlegen, um sie zu schwächen.
Chinas Umwelt bezahlt einen teuren Preis
Dass dieses Unterfangen einfach wird, glaubt keiner. Aber manches spricht dafür, dass es möglich ist. Unter Ökonomen gibt es für Chinas derzeitige Vorherrschaft einen Begriff: bestreitbares Monopol. Das liegt dann vor, wenn zwar ein Anbieter die ganze Welt allein mit seinen Produkten versorgt – aber nur solange er die günstigsten Preise bietet. Das ist etwas fundamental anderes als ein Monopol, das auf staatlicher Regulierung, Marktstrukturen oder der Kontrolle über knappe Ressourcen beruht.
China hätte demnach nur genau so lange ein Monopol auf diese kritischen Rohstoffe, wie es diese Stellung nicht ausnutzt. Denn Seltene Erden sind, so geht das in diesen Tagen überstrapazierte Bonmot, nicht selten. Über viele Jahre hatten westliche Unternehmen schlicht keinen Grund, andere, teurere Quellen zu erschließen. Das hat sich nun geändert. Von Amerika über Europa bis nach Australien formieren sich Alternativen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Mine bis zur Herstellung der Hochleistungsmagneten, die in E-Autos, Windturbinen, Drohnen und Smartphones verbaut werden.
Nach dieser Lesart hätte China mit seiner über Jahrzehnte aufgebauten und teuer erkauften Dominanz nur einen taktischen Sieg errungen und sich für wenige Jahre vor ruinösen Zollattacken Trumps geschützt. Und Chinas Umwelt und die lokale Bevölkerung hätten einen wohl zu hohen Preis dafür bezahlt.
Das lässt sich in Jiangxi, wo Xi vor sechs Jahren seine Warnung an die USA verschickte, bis heute beobachten. Die Bewohner meiden das Grundwasser bis heute. Das chinesische Industrieministerium schätzte die Kosten für die Aufräumarbeiten, nachdem viele Minen geschlossen wurden, einst auf umgerechnet rund fünf Milliarden Euro. Ist ein Pyrrhussieg im Handelskrieg so viel wert?
Nach einer anderen Lesart müht sich der Westen nun zwar, Chinas Dominanz zu brechen. Doch er müht sich vergeblich. Der Westen könne nun Milliarden und Abermilliarden in den Aufbau einer eigenen Lieferkette stecken, lautet die dazugehörige Argumentation, aber wenn China seinen Preisvorteil ausspiele, würden all diese Projekte wieder unwirtschaftlich. Denn beim Preis werde man mit China eh nie konkurrieren können. Das Geld stecke man besser in andere, zukunftsträchtigere Industrien.
Kaum einer vertritt diese These mit größerer Verve als Thomas Kümmer. Kümmer ist ein Urgestein der Rohstoffindustrie und hat von 1988 bis 2019, mit einer zehnjährigen Unterbrechung, in China gelebt. Er hat in den vergangenen Jahrzehnten viele Aufmerksamkeitswellen für die Seltenen Erden kommen und gehen gesehen. „In zehn Jahren wird sich wieder niemand mehr an die Probleme von heute erinnern“, sagt Kümmer. „Dann hat man Milliarden in Projekte gesteckt und Firmen geschaffen, für deren Produkte es keinen Bedarf gibt.“ Am Ende würden sich Unternehmen immer für die günstigsten Produkte entscheiden. „Und die chinesischen Produkte sind eben 30 Prozent günstiger.“
Entscheidend wird also wohl sein, ob die Industrie verstanden hat, dass China kein sicherer Lieferant mehr ist – und welchen Aufpreis sie bereit ist, für Alternativen zu zahlen.
Autozulieferer verlagern nach China
Nicht jeder Schritt ist dabei unbedingt zielführend. Trump ist in dieser Woche durch Asien getourt und hat lauter Partnerschaften für Seltene Erden geschlossen. Kümmer lässt an diesen Bemühungen kein gutes Haar. „In Asien greifen die USA gerade die schlechtesten Projekte ab. Dabei gibt es an den Rohstoffen keinen Mangel.“ Die Versuche, eine Magnet-Produktion in den USA aufzubauen, hält er für ebenso wenig aussichtsreich. „China produziert mehr als 300.000 Tonnen an Seltenerdmagneten im Jahr. Wir quälen uns mit 1000 Tonnen“, rechnet Kümmer vor. „Vollständige Unabhängigkeit von China werden Sie nie erreichen.“
Die unsichere Versorgung mit Seltenen Erden im Ausland bringt zudem gerade nicht wenige Unternehmen dazu, weitere Produktion nach China zu verlagern. Dort sind die Rohstoffe und die Magnete weiter erhältlich. Für fertige Produkte sind die Exportregeln viel laxer als für Mineralien und Vorprodukte. Vereinzelt berichten Autozulieferer schon, dass sie diese Strategie verfolgen, wenn die Seltenen Erden mal wieder knapp werden.
Wie schnell sich allerdings die Dinge ändern können, zeigt sich am Beispiel von Gallium. Das Element zählt nicht zu den Seltenen Erden, ist aber ein wichtiger Bestandteil von elektronischen Geräten und wird als Galliumarsenid zum Beispiel in Smartphones oder als Galliumnitrid in Netzteilen verwendet. 99 Prozent des Galliums wurden im vergangenen Jahr in China produziert – nicht, weil nur China Gallium hätte oder wüsste, wie man es abbaut. Gallium ist ein Nebenprodukt der Aluminiumverarbeitung. Bis 2016 wurde es auch in Deutschland produziert, bevor China dank günstiger Preise die deutschen Wettbewerber aus dem Markt drängte.
Chinas Gallium-Monopol ist bald Geschichte
Dann begann China im Jahr 2023, Gallium mit Exportbeschränkungen zu belegen. Seitdem ist hinter den Kulissen Bewegung in den Markt gekommen. In Griechenland entsteht gerade eine Galliumfertigung, die 2027 den Betrieb aufnehmen und ab 2028 jährlich 50 Tonnen produzieren soll – genug, um mit nur dieser einen Fabrik den gesamten Bedarf Europas zu decken. Weitere 100 Tonnen im Jahr sollen ab 2026 aus einer einzigen Fertigung in Australien kommen. Der Anreiz für weitere Projekte ist da. Das chinesische Galliummonopol ist de facto schon jetzt Geschichte.
Tim Worstall ist deshalb deutlich optimistischer, was die westliche Aufholjagd angeht. Er ist Ökonom am liberalen Adam-Smith-Institut und ehemaliger Großhändler für Seltene Erden. Worstall hält es schon für ein Missverständnis, dass der Abbau der Erden mit schweren Umweltschäden gleichgesetzt werde. Das liege an den lockeren chinesischen Standards. „Es gibt keinen Grund, warum der Abbau Seltener Erden mit mehr Umweltverschmutzung einhergehen müsste als andere Arten des Bergbaus.“ Der einzige Unterschied liege in der radioaktiven Strahlung des an den Abbaustätten freigesetzten Elements Thorium.
Doch diese Strahlenbelastung liegt weit unterhalb sicherer Grenzwerte, wie eine Auswertung der Internationalen Atomenergiebehörde zeigt. Kurz gesagt: Von Deutschland nach Österreich zu ziehen, geht mit einem mehrfach höheren Strahlenrisiko einher, als in einer Mine für Seltene Erden zu arbeiten. Demnach stünde schon dem Abbau der Erze, dem ersten Schritt in der Wertschöpfungskette, in Europa nichts entgegen. Das größte Vorkommen des Kontinents wurde erst 2023 in Schweden entdeckt. Es könnte allein 18 Prozent des heimischen Bedarfs decken.
Die Kapitalmärkte jedenfalls sind zuversichtlich, dass Seltene Erden außerhalb Chinas eine Zukunft haben. Gerade fließt so viel Geld in den Sektor wie nie zuvor. Die amerikanische Großbank JP Morgan will zehn Milliarden Dollar in Unternehmen investieren, die für die nationale Sicherheit der USA relevant sind, einschließlich Produzenten wichtiger Mineralien. Der Private-Equity-Fonds Orion Research Partners hat gerade ein 1,8-Milliarden-Dollar-Investment in die Produktion Seltener Erden angekündigt, mit Geld aus den USA und Abu Dhabi. Der Aktienkurs von MP Materials, dem Betreiber der größten Mine für Seltene Erden in den USA, hat sich in diesem Jahr mehr als verdreifacht, das Unternehmen ist jetzt elf Milliarden Dollar wert. Die Summen sind groß für eine vergleichsweise kleine Branche.
Fünf Jahre Zeit
In einem Bericht aus dem Jahr 2023 schätzt die Großbank Goldman Sachs, dass es 15 bis 30 Milliarden Dollar kosten würde, Chinas Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Magneten zu ersetzen – ein Kleinbetrag in einem globalen Wettrüsten. Die deutsche Regierung wollte schließlich allein zehn Milliarden Euro für eine Chipfabrik in Magdeburg zahlen. Sorgen bereitet da vor allem die kurze Frist. Doch gerade die besonders zeitkritische Rüstungsbranche, für die China die Nutzung der Mineralien untersagen will, hat zuletzt eher beschwichtigt: Rheinmetall habe ausreichend Vorräte für fünf Jahre, sagte der Vorstandsvorsitzende des größten deutschen Rüstungskonzerns, Armin Papperger, im September.
In fünf Jahren kann viel passieren. Im französischen La Rochelle stand einst einer der weltweit größten Produktionsstandorte für die Trennung der Mineralien, den ersten Schritt der Weiterverarbeitung, bevor China das Geschäft an sich zog. Der Betreiber der Fabrik, der belgische Chemiekonzern Solvay, hat im April eine Expansion der Fabrik angekündigt – wenige Tage nachdem China erstmals in diesem Jahr die Ausfuhr Seltener Erden einschränkte. Bis 2030 will Solvay 30 Prozent des europäischen Bedarfs decken.
Die Liste lässt sich fortsetzen: Less Common Materials, eines der wenigen Unternehmen außerhalb Chinas, das sich auf den Zwischenschritt der Metallisierung spezialisiert hat, sitzt in der englischen Grafschaft Cheshire. Gerade hat der amerikanische Konzern USA Rare Earth das Unternehmen übernommen und transatlantische Kompetenzen gebündelt. Erst im September hat in der Stadt Narva in Estland eine Fabrik für den letzten Schritt der Wertschöpfungskette eröffnet, die Herstellung der Magneten. Die estnische Fabrik ergänzt die Kapazitäten des Hanauer Magnetproduzenten VAC, der in Deutschland und Finnland produziert und gerade den Bau eines neuen US-Werks vorantreibt.
Den vollständigen Bedarf Europas werden diese Anbieter auf absehbare Zeit nicht decken können. Aber: Das Knowhow ist vorhanden. Jetzt kommt es auf die schnelle Expansion an. Die Anreize haben sich grundsätzlich verändert. Und der Aufschub der chinesischen Exportkontrollen um ein Jahr, den Donald Trump am Donnerstag ausgehandelt hat, gibt dem Westen wertvolle Zeit. Vorerst liefert China weiter.
Das ist die Sache mit Trumpfkarten. Sind sie einmal gespielt, gibt es kein Zurück.