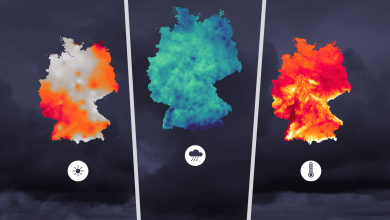Deutsche Außenpolitik: Unabhängig werden von Amerika | ABC-Z

Für einen Bundeskanzler, der sich vor allem um die Außenpolitik kümmern will und muss, blieb Friedrich Merz in seiner ersten Regierungserklärung erstaunlich vage, als es um die Vereinigten Staaten ging. Er nannte Deutschlands formal immer noch wichtigsten Verbündeten im Zusammenhang mit der Ukraine und mit Handelsfragen. Aber grundsätzliche Ausführungen dazu, wie sich die transatlantischen Beziehungen entwickeln sollen, fehlten in seiner Rede. Dabei ist das die Frage des Jahrhunderts – für Deutschland, aber auch für ganz Europa.
Die Zurückhaltung des Kanzlers mag man mit den Erfordernissen der Diplomatie begründen. Merz hatte gerade erste Telefonate mit Trump hinter sich, sie waren offenbar gut verlaufen. Die schwierigen Beziehungen zu diesem schwierigen Präsidenten muss man da nicht mit der öffentlichen Erörterung von Grundsatzfragen belasten. Auffällig war allerdings eine Äußerung des neuen Außenministers Johann Wadephul: Er habe „im Kern“ nie Zweifel daran gehabt, „dass die Vereinigten Staaten an unserer Seite stehen“, sagte er kurz nach seinem Amtsantritt.
Wandel in der öffentlichen Debatte
Das ist nicht nur wegen der Volten, die Trump in der Ukrainepolitik schlägt, eine überraschende Einschätzung. Wer in den vergangenen Jahren Zeitung gelesen hat, kann eigentlich nicht mehr auf einen grundlegenden Kurswechsel in Washington hoffen. Nicht nur Trumps erste Amtszeit bietet reichlich Anschauungsmaterial für das (außen-)politische Verständnis des Präsidenten. Es hat auch ein tiefgreifender Wandel in der öffentlichen Debatte in Amerika stattgefunden. Trumps Mischung aus Protektionismus, Isolationismus, Expansionismus und Nativismus ist auch deshalb populär, weil sie auf historische Prägungen des Landes zurückgreift. Das wird in Europa oft übersehen.
Hinzu kommt die Veränderung der globalen Machtbalance zugunsten von Staaten wie China, Russland, Indien, aber auch der Türkei, Saudi-Arabien, Brasilien und einigen anderen. Man sollte nicht unterschätzen, wie sehr das Amerikas Weltmachtrolle strapaziert, die hohen Schulden des Landes sind auch eine Folge davon. Biden wollte diesem Umbruch mit einer erneuerten westlichen Allianz begegnen. Daran glaubt Trump nicht. Im Gegenteil: Er betrachtet auch die EU als Konkurrenz.
Kein selbstverständlicher Partner mehr
Wie weit der Präsident seinen Rückzug aus Europa (und anderen Teilen der Welt) treiben wird, ist noch nicht absehbar. Eines aber ist für die nächsten vier Jahre gewiss, wahrscheinlich auch darüber hinaus: Amerika ist für Deutschland (und Europa) in der neuen multipolaren Welt kein selbstverständlicher Partner mehr, sondern nur noch einer, wenn es gemeinsame Interessen gibt. Das ist eigentlich die Normalität in der Weltpolitik, in der Geschichte war es nie anders. In Deutschland klammert man sich noch zu sehr an die Sondersituation des Kalten Krieges. Die wird nicht wiederkehren.
Es geht also im Kern um das, was Merz nach der Bundestagswahl sagte: Europa muss tatsächlich Schritt für Schritt die Unabhängigkeit von den Vereinigten Staaten erreichen. Zwei Leitsätze sollten die deutsche Außenpolitik der nächsten Jahre prägen. Mit Amerika sollte man zusammenarbeiten, wo immer es geht. Parallel dazu müssen das Land und die EU aber selbst handlungsfähig und vor allem handlungswillig werden. Die To-do-Liste dafür ist bekannt, sie geht über die reine Außenpolitik hinaus: Aufrüstung, die Wiederherstellung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit, die Gewinnung neuer und Rückversicherung alter Verbündeter, vor allem in Europa. Die Ampel hat auf allen drei Feldern ein schweres Erbe hinterlassen.
Das Grummeln in der SPD über ein mögliches Fünf-Prozent-Ziel in der NATO ist da kein Ausweis von Einsicht in die strategischen Notwendigkeiten. Es geht hier nicht darum, Trump einen Gefallen zu tun, sondern darum, die Bundeswehr (und andere europäische Armeen) wieder in einen Zustand zu versetzen, der Russland abschreckt. Die Koalition hat sich mit der Grundgesetzänderung den nötigen fiskalischen Spielraum verschafft, den muss sie nun im Interesse des Landes nutzen. Ähnlich steht es um die nukleare Frage. Natürlich sollte man die Zusammenarbeit mit Amerika hier nicht ohne Not aufgeben. Aber Macrons Angebot für eine Stationierung französischer Atomwaffen bei europäischen Partnern liegt auf dem Tisch. Der nukleare Habenichts Deutschland kann es sich nicht leisten, es auszuschlagen.
Selbst ein schrittweiser Abschied von Amerika wird alten Atlantikern wie Merz nicht leichtfallen. Deutschland erfährt nun aber, welchen Preis die Einbindung in internationale Kooperation hat, die es weiter getrieben hat als die meisten anderen Länder: Sie führt zu Abhängigkeit, im schlimmsten Fall zu Machtlosigkeit. Sich davon zu befreien, zumindest so weit es geht, macht Deutschland nicht zu einem schlechteren Partner anderer Länder, eher zu einem besseren.