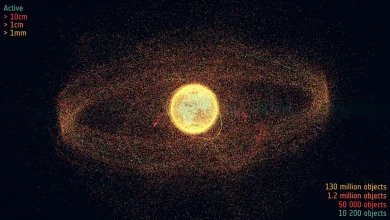Maler Anders Zorn in Hamburg: Weltmann, tief in Schweden verwurzelt | ABC-Z

Jahrmarkt in der schwedischen Provinz: Im Hintergrund streben die Besucher zu Fuß und in Pferdewagen einen Hang hinauf ins Städtchen dem Vergnügen entgegen. Das ist für einen von ihnen allerdings schon vorbei: In der rechten unteren Ecke des Bildes, hart an die Kante platziert, sind Rücken und Hinterkopf eines auf dem Erdboden liegenden Mannes zu sehen. Vor ihm im sattgrünen Gras sitzt, in einen rot gestreiften Festtagsrock gekleidet, seine Frau und blickt resigniert ins Leere. Sie wartet darauf, dass der Betrunkene seinen Rausch ausschläft. Den Hut des Gatten hält sie in der Hand. Das Bild vereinigt viel von dem, was das Werk des Künstlers Anders Zorn, 1860 im schwedischen Mora geboren und dort 1920 auch gestorben, ausmacht: eine meisterhafte Technik, die einen impressionistischen Pinselstrich, leuchtende Farbigkeit, überraschende Bildausschnitte und tiefe, Dynamik vermittelnde Perspektiven mit einem naturalistischen Blick auf die Wirklichkeit verbindet.
Auch die Szenerie – Zorns in der Mitte Schwedens gelegenem Heimatstädtchen Mora entnommen – steht für einen wichtigen Teil seines Schaffen: Das Leben der Bauern, Handwerker, Arbeiter und die nordischen Landschaften, in die es eingebettet ist, bildet einen großen Teil seines Motivrepertoires. Aber es beschränkt sich keineswegs darauf: Einen Gegenpol zu den Ansichten aus dem schwedischen Landleben bilden Porträts von den Schönen, Reichen und Mächtigen aus Europas und Nordamerikas High Society – zahlreiche Magnaten und Damen der Gesellschaft, das schwedische Königspaar, zwei US-Präsidenten. Die Hamburger Kunsthalle präsentiert nun – kuratiert von Markus Bertsch, Jana Kunst und Michelle Adler – mit über 150 Gemälden, Aquarellen, Radierungen und einigen Skulpturen die bislang größte Anders-Zorn-Ausstellung.
Wie Warhol wusste er sich bestens zu vermarkten
Das knallige „Superstar“-Etikett, das man ihm in der Kunsthalle angeheftet hat, lässt auf den ersten Blick eher an Andy Warhol denken als an einen Malerfürsten des 19. Jahrhunderts, wie ihn Zorn verkörperte. Doch auf den zweiten Blick passt es durchaus: Wie Warhol hatte Zorn, als uneheliches Kind eines deutschen Brauereimeisters und einer schwedischen Saisonarbeiterin aus ärmlichen Verhältnissen stammend, ein ausgeprägtes Talent für die Vermarktung seiner Arbeiten und die Inszenierung seiner selbst. Schon in seiner Zeit auf der Stockholmer Kunstakademie knüpfte er zur richtigen Zeit karrierefördernde Kontakte, er verkaufte schon früh Bilder zu hohen Preisen, war in der Presse präsent, liebte – zumindest zeitweise – den Glamour und verstand es, mit seiner Kunst reich zu werden, ohne Abstriche an der Qualität zu machen.

Zorn, dessen Bilder in den großen Ausstellungen Europas gezeigt und ausgezeichnet wurden, war selbst äußerst mobil. Gemeinsam mit seiner Frau Emma Lamm, die als seine Managerin großen Anteil an seinem kommerziellen und gesellschaftlichen Erfolg hatte, wohnte er mehrere Jahre zunächst in London und dann in Paris. Etliche ausgedehnte Reisen führten ihn in die USA, nach Nordafrika und nach Spanien, das mit Darstellungen glutäugiger Frauen und maurisch geprägter Architektur einen großen Raum in seinem Werk einnimmt.
Er platzierte seine Modelle in ihren alltäglichen Umgebungen
Die handwerkliche Brillanz, die Strahlkraft und erzählerische Lebendigkeit der Bilder machen den Gang durch die Ausstellung zu einem ästhetischen Genuss. Die Aquarelle, mit denen Zorn begann, stehen der Ölmalerei, zu der er später überging, in ihrer Qualität in nichts nach. Auch als Grafiker überzeugt er, wie die große Auswahl an Radierungen zeigt, die in der Ausstellung zu sehen sind. Einen wichtigen Teil des Œuvres bilden die Porträts: Zorn malte die Personen nicht im Atelier, sondern platzierte sie in ihren alltäglichen Umgebungen, erfasste sie in typischen Posen und bei charakteristischen Tätigkeiten: Der Bankier sitzt an seinem Schreibtisch im gediegen eingerichteten Arbeitszimmer, zwischen den Fingern eine Zigarre haltend; die Dame der Gesellschaft im elegant-farbenfrohen Abendkleid hat im Salon Platz genommen, den Arm lässig auf die Rückenlehne des seidenbezogenen Sofas gelegt; der Schauspieler agiert auf der Bühne, der Opernsänger probt vor dem Notenpult. Oft hat der Betrachter den Eindruck, die Dargestellten wendeten sich aus dem Bild heraus direkt an ihn. Sich selbst porträtierte Zorn allerdings durchaus im Atelier – schließlich war das sein berufliches Umfeld.

Zwischen der Hamburger Kunsthalle und Zorn gibt es eine besondere Beziehung: Im Winter 1891/92 hielt er sich auf Einladung des Direktors Alfred Lichtwark in der Hansestadt auf, wo er mehrere Ansichten des Hafens malte. Sie zeigen eine besondere Könnerschaft Zorns: Hier wie auch in seinen See-, Meeres- und Flussbildern erreicht die Gestaltung der Wasseroberflächen und des darauf tanzenden Lichts eine fast hypnotische Wirkung. Ein besonders eindrückliches Beispiel dafür bietet die „Kirchenbucht auf Lidingö“. Der Blick durch filigrane Zweige mit federartigen Blättern und Nadeln auf die Bucht zieht den Betrachter hinab in ein flirrendes Wellengekräusel.
In seiner Heimatstadt gründete er ein Atelier wie auch ein Waisenhaus
1896 ließen sich Anders und Emma Zorn dauerhaft in seiner Heimatstadt Mora nieder. Dort errichteten sie Zorngården, ein repräsentatives Anwesen, gründeten ein Waisenhaus und eine Volkshochschule für die Berufsausbildung junger Menschen und begannen mit den Planungen für ein Freilichtmuseum, das helfen sollte, alte handwerkliche Techniken und dörfliche Traditionen zu bewahren. Eröffnet wurde es allerdings erst neunzehn Jahre nach Zorns Tod.

Als er 1920 starb, nannte ihn eine schwedische Zeitung den „am tiefsten in Schweden verwurzelten Künstler“. Der Kosmopolit war zum schwedischen Nationalkünstler geworden, und er ist es bis heute geblieben, wie die Teilnahme der schwedischen Botschafterin an der Ausstellungseröffnung deutlich machte. Im Rest der Welt allerdings verblasste Zorns Stern nach dem Ersten Weltkrieg. Angesichts der damals aktuellen Kunstströmungen – Expressionismus, Surrealismus, Neue Sachlichkeit – erschien sein Werk jetzt altmodisch. Deutsche Museen, auch die Hamburger Kunsthalle, verkauften seine Werke. Nun erlebt Zorn, dem 2012 bereits eine kleinere Ausstellung in Lübeck gewidmet war, ein verdientes Comeback auf großer Bühne.