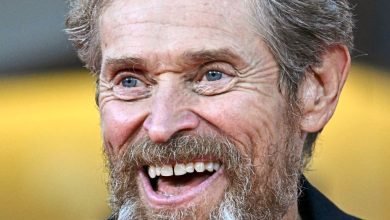Demenz-Anzeichen: „Die meisten Patienten zeigten zum ersten Mal in ihrem Leben kriminelles Verhalten“ |ABC-Z

Diebstahl, Belästigung und Verkehrsdelikte: Das könnten erste Anzeichen für eine Demenzerkrankung sein. Forscher fanden heraus, woran das liegt und wann das Risiko für kriminelles Verhalten wieder sinkt.
Demenzkranke Menschen können auffällig werden. Nicht nur durch Vergesslichkeit oder Verwirrung, sondern auch durch kriminelles Verhalten. Das reicht von Belästigung über Verkehrsdelikte und Diebstahl bis hin zum Verletzen von Tieren. Selbst wenn der Täter von Demenz betroffen ist – es bleibt eine Straftat. Für die betroffenen Familien kann das gravierende Folgen haben. Wie dieses Phänomen entsteht, hat nun eine Metaanalyse von 14 Studien aus den USA, Schweden, Finnland, Deutschland und Japan untersucht.
Vor allem im frühen Stadium der Krankheit verhalten sich demnach mehr als die Hälfte der Betroffenen regelwidrig. Das Risiko, straffällig zu werden, ist dann deutlich höher als bei der Allgemeinbevölkerung.
„Die meisten Patienten zeigten zum ersten Mal in ihrem Leben kriminelles Risikoverhalten und hatten zuvor keine Vorstrafen“, erklärt Hauptautor Matthias Schroeter vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Die Forscher schlussfolgern daraus einen frühen Indikator: Wird jemand im mittleren Alter plötzlich kriminell, könnte das auf ein frühes Stadium der Demenz hinweisen. Auffällig sei außerdem, dass Männer nach einer Demenzdiagnose viermal häufiger Verbotenes tun als Frauen.
Im weiteren Krankheitsverlauf nimmt diese Gefahr jedoch wieder ab. Menschen mit fortgeschrittener Demenz gelten laut der Studie sogar als weniger gefährlich als der Durchschnitt der Bevölkerung.
Warum Betroffene kriminell werden, liege an der Erkrankung selbst, mutmaßen die Forscher. In einer zweiten Studie fanden sie heraus, dass sich das Gehirn der Erkrankten verändert hatte. Wegen der sogenannten „Enthemmung“ konnten die Betroffenen ihre Impulse, Emotionen und somit ihr Verhalten schlechter regulieren. Ohne die Konsequenzen zu überdenken, verhielten sie sich impulsiv, oft nicht der Situation angemessen.
Schroeter will mit seiner Arbeit zeigen, dass es mehr Bewältigungsstrategien für kriminelles Verhalten bei Demenzkranken braucht. Medizinische und rechtliche Systeme müssten besser zusammenarbeiten. „Wir hoffen, dass die Studie zu einem besseren Verständnis der möglichen Auswirkungen solcher Erkrankungen beiträgt, mögliche Ursachen aufzeigt und interdisziplinäre Bemühungen zur Entwicklung von Bewältigungsstrategien fördert“, erklärt er in einer Mitteilung des Instituts.
Er warnt aber auch vor einer Überbewertung der Ergebnisse. Er wolle eine weitere Stigmatisierung von Menschen mit Demenz verhindern. „Bemerkenswert ist, dass es sich bei den meisten Straftaten um geringfügige Vergehen wie unangemessenes Verhalten, Verkehrsdelikte, Diebstahl und Sachbeschädigung handelte, aber auch körperliche Gewalt oder Aggressionen vorkamen“, erklärt er und fordert mehr Sensibilität für die ersten Symptome. Auch das Rechtssystem müsse angepasst werden, indem es etwa die Erkrankung bei der Verhängung von Strafen und im Strafvollzug mehr berücksichtige. Oft wird demnach eine Demenz zu spät erkannt, das Verhalten nicht mit ihr in Zusammenhang gebracht.
Sind Demenzkranke schuldfähig?
Auf der Informationsseite „Wegweiser Demenz“ des Bundesfamilienministeriums heißt es dazu: „Um strafrechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden, müssen Täter schuldfähig, also in der Lage sein, das Unrecht der Tat einzusehen und entsprechend zu handeln“, heißt es dort. Können Erwachsene aufgrund krankhafter seelischer Störungen das Unrecht der Tat nicht einsehen, gelten sie als schuldunfähig. In der Regel gehe man davon aus, heißt es weiter, dass Demenz zu einem Abbau kognitiver Funktionen führe. Bei leichter Demenz könne daher von einer verminderten Schuldfähigkeit ausgegangen werden. Liegt eine mittelschwere Demenz vor, gilt ein Mensch als schuldunfähig. Strafrechtliche Verfahren werden dann eingestellt.
Laut der Deutschen Alzheimer Gesellschaft nimmt die Anzahl der Menschen mit Demenz stetig zu. Falls keine künftige Therapie verhindern kann, dass Menschen erkranken, könnten allein in Deutschland nach aktuellen Schätzungen im Jahr 2050 bis zu 2,7 Millionen Menschen über 65 an Demenz leiden. Frauen sind häufiger betroffen als Männer.