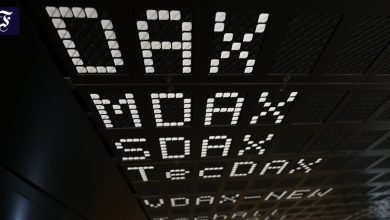Das trockene Frühjahr macht Tieren zu schaffen – Wissen | ABC-Z

Wenn es ganz schlimm wird, karrt Norbert Schäffer ein paar hundert Liter Wasser zur Sandgrube in seiner Nähe. Dort legt die seltene Kreuzkröte im nur wenige Zentimeter tiefen Wasser ihren Laich ab. „Wenn die Sandgrube austrocknet, geht der Laich kaputt und die Kaulquappen verenden“, sagt der Vorsitzende des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz (LBV) in Bayern. „Ich weiß, dass das eigentlich eine hilflose Maßnahme ist, die in der Sache insgesamt nicht viel bringt. Aber ich muss es einfach machen.“
Die Sache insgesamt – das ist das ungewöhnlich trockene Frühjahr in vielen Regionen Deutschlands, das der Natur zunehmend zu schaffen macht. Anders als kürzlich von der Eichhörnchenhilfe Berlin/Brandenburg suggeriert, ist die Situation zwar noch nicht so dramatisch, dass die Eichhörnchen in Deutschland massenhaft von den Bäumen fallen und vom Aussterben bedroht sind, weil sie nichts mehr zu trinken finden. „Wir machen uns keine Sorgen um die Eichhörnchen“, sagt Jennifer Calvi von der Deutschen Wildtier Stiftung.
Doch auch wenn sie deshalb nicht gleich aussterben – die Trockenheit macht tatsächlich vielen Wildtieren zu schaffen. Das Frühjahr ist für sie ohnehin eine schwierige Zeit, da sie dann ihre Jungen großziehen. Vögel zum Beispiel können Dürren normalerweise ausweichen, indem sie einfach anderswohin fliegen, wo es mehr Wasser gibt. Wenn sie aber ihr Nest gebaut haben und brüten, ist das nicht möglich. „Sie können dann sechs bis acht Wochen nicht weg“, sagt Schäffer.
Amseln finden keine Regenwürmer mehr
Schilfbrüter wie Rohrsänger bauen ihre Nester auf Schilfinseln, die von Wasser umgeben sind, damit sie vor Füchsen und Raubtieren geschützt sind. „Wenn der Wasserstand niedrig ist, kann der Fuchs ins Schilf rein“, sagt Schäffer. Problematisch kann die Trockenheit auch für Feuchtwiesenbrüter sein wie die sehr seltene Uferschnepfe, Brachvogel und Rotschenkel. Diese Tiere suchen und finden ihre Nahrung, indem sie mit ihren langen dünnen Schnäbeln im feuchten Boden herumstochern. Wenn der Boden ausgetrocknet ist, scheitern sie an der harten Oberfläche, sodass sie und ihr Nachwuchs verhungern. „Sie haben dann sozusagen das falsche Esswerkzeug, sagt Schäffer.“
Problematisch ist die Trockenheit auch für Arten wie Amseln, die sich hauptsächlich von Regenwürmern ernähren und Stare, die im Frühjahr auf die proteinreichen Würmer für sich und ihren Nachwuchs angewiesen sind. Regenwürmer wandern bei Trockenheit nämlich in tiefere, noch feuchte Bodenschichten, wo sie für die Vögel nicht mehr zu erreichen sind. „Weißstörche füttern ihre Jungen in den ersten zwei Wochen sogar ausschließlich mit Regenwürmern“, sagt Schäffer. Wenn es ausgerechnet in dieser Zeit sehr trocken ist und sie keine finden, verhungert der Nachwuchs.
Auch Amphibien macht das trockene Frühjahr zu schaffen. Viele Erdkröten, Grasfrösche und andere sind dieses Jahr nicht gewandert, um sich zu paaren, weil es zu trocken war. Deshalb wird es dieses Jahr weniger Nachwuchs geben.
Auch auf Säugetiere wirken sich Trockenheit und Hitze aus. „Die meisten heimischen Arten haben eine Komfortzone zwischen 13 und 23 Grad Celsius“, sagt Konstantin Börner, Biologe am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Wenn es wärmer wird, geraten sie in Hitzestress. Rehe und Hirsche brauchen dann doppelt so viel Wasser wie die normalen ein bis zwei Liter pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn Wildschweine unter starken Hitzestress gerieten, könnten sogar innere Organe geschädigt werden, sodass die Tiere kollabieren und sterben, so Börner.
Feldhasen und Borkenkäfer profitieren von der Trockenheit
Rehe und Wildschweine sind zwar nicht bedroht, trotzdem ist es verblüffend, welche Auswirkungen der Klimawandel und die damit verbundene Hitze und Trockenheit auf diese Arten jetzt schon haben. Wenn der Sommer heiß ist, entwickele sich bei vielen Ricken nur ein Embryo, sagt Börner. Normalerweise sind es zwei. „Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Verfassung der Rehe schlecht ist.“
Bei problematischen Umweltbedingungen wie Trockenheit und Hitze würden bei allen Säugetieren zudem mehr Weibchen als Männchen geboren. Weibliche Embryonen sind weniger empfindlich und haben deshalb bessere Überlebenschancen. Börner erklärt es am Beispiel der Rehe: Ein Weibchen als Nachwuchs ist sozusagen die sichere Variante, bei der, wenn alles gut läuft, jedes Jahr zwei Enkel geboren werden. Sind die Bedingungen gut und ist die Mutter in guter Verfassung, kann sie das Risiko eingehen, männlichen Nachwuchs zu bekommen. Denn es ist wahrscheinlich, dass er überlebt, später vielleicht sogar Platzhirsch wird und jedes Jahr viele Nachkommen zeugt. Aus evolutionsbiologischer Sicht ist das der Jackpot.
Auch wenn der Nachwuchs geboren ist und gesäugt werden muss, ist Trockenheit ein Problem. Erstens geben die Mütter weniger Milch, wenn sie nicht genug zu trinken haben. Und zweitens verändert sich auch die Zusammensetzung der Milch, weil es auch den Pflanzen schlecht geht, die die Mütter fressen.
Allerdings gibt es auch Tiere, die von der Trockenheit profitieren, sagt Börner. Feldhasen zum Beispiel. „Feldhasen sind thermophile Tiere, deren Nachwuchs besser überlebt, wenn das Frühjahr warm und trocken ist.“ Hitze macht den Hasen kaum etwas aus, da sie über ihre langen Löffel viel Wärme abgeben können.
Auch manche Schädlinge haben einen Vorteil von der Trockenheit. Der Borkenkäfer zum Beispiel. Bei Trockenheit und Wärme kann er mehrere Generationen bilden, sich in Massen vermehren und große Schäden in den Wäldern anrichten. „Davor haben Försterinnen und Förster gerade Angst“, sagt Schäffer.
Doch die meisten Tiere leiden unter Wasserknappheit. Was kann man tun, um ihnen zu helfen? „Grundsätzlich ist ein Umdenken beim Umgang mit Wasser erforderlich“, sagt Schäffer. „Wasser wurde früher fast wie ein Schädling behandelt, den man so schnell wie möglich loswerden wollte.“ Deshalb liegen beispielsweise in vielen Äckern und Wiesen Drainage-Rohre, die das Wasser bei Regen schnell abführen. „Diese Rohre sollten entfernt werden, damit das Wasser länger in der Fläche bleibt“, sagt Schäffer. Dasselbe gelte für Entwässerungsgräben.
Wer Tieren bei Trockenheit helfen will und einen Garten hat, kann Wasserschalen aufstellen, am besten mit Steinen darin, dann können auch Insekten daraus trinken. Damit Vögel und andere Tiere beim Trinken nicht von einer Katze überrascht werden, ist es sinnvoll, dornige Zweige um die Tränke herumzulegen. Außerdem gibt es hängende Vogeltränken, die man an einem Ast befestigen kann, sodass Katzen keine Chance haben.
Ein scheinbar entkräftetes Tier in eine Auffangstation zu bringen, ist dagegen nicht immer eine gute Entscheidung. Vor allem bei Jungvögeln sollte man genau hinschauen. „Sie wirken oft hilflos, sind es in aller Regel aber nicht“, sagt Schäffer. Meist seien die Eltern irgendwo in der Nähe und kümmern sich. Wo es viele Katzen gibt, sei es sinnvoll, sie etwas erhöht in einen dornigen Busch zu setzen, und wegzugehen. Mitnehmen sollte man sie aber nicht.