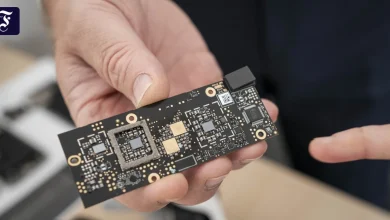Technologieoffenheit gegen verordnete Antriebstechnik | FAZ | ABC-Z

Erinnert sich noch jemand an Miriam Dalli? Sie ist jene maltesische Politikerin, die als Berichterstatterin im Umweltausschuss des EU-Parlaments als maßgebliche Architektin des Verbrennerverbots und seiner es bis 2035 begleitenden Strafzahlungen gilt. 2018 war das, Dalli ist nicht mehr in Brüssel. Sieben Jahre später steht Europa vor den Trümmern jener unter Fehleinschätzung der Realität verordneten De-facto-Festlegung auf eine Antriebstechnik für das Automobil. Vor Trümmern, die übrigens nicht in Malta zu beklagen sind, sondern in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien.
Sieben Jahre später ringt Deutschland um seine industrielle Basis. Und im Bundestag spielt sich ein neuer Tiefpunkt ab. In den Debatten der vergangenen Woche ist es jener Moment, als Heidi Reichinnek, das Gesicht der Linken, während der Rede von Bundeskanzler Friedrich Merz unter spöttischem Lachen an ihrem Sitz zusammenklappt. „Viele von Ihnen mögen diesen Begriff nicht, aber der Begriff ist ein Schlüsselbegriff, auch für diese Bundesregierung. Er heißt Technologieoffenheit“, hatte der Kanzler gesagt. Und: „Wir gehen den Weg nicht mit Verboten, nicht mit übertriebener Regulierung, sondern mit Technologie.“
Es spricht einiges dafür, dass Wohlstand erst erwirtschaftet gehört, bevor er verteilt wird. Vermutlich können das Ingenieure und Betriebswirte oft ideenreicher als Politiker. Es dürfte sich auszahlen, Firmen, Universitäten, Forschungsinstituten Freiraum und Vertrauen zu schenken, auf dass sie gute, wettbewerbsfähige Produkte entwickeln. Das höhnische Gelächter von der wohlgeheizten Abgeordnetenbank haben sie nicht verdient, die 13.000 Menschen bei Bosch, die im eisigen Wind des verzerrten Wettbewerbs ihre Stelle verlieren. Und die vielen Tausend Mitarbeiter, Hochschulabsolventen und Azubis, die gerade quer durch die (Auto-)Industrie auf der Strecke bleiben, auch nicht.