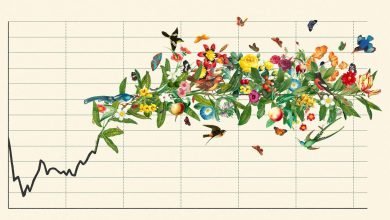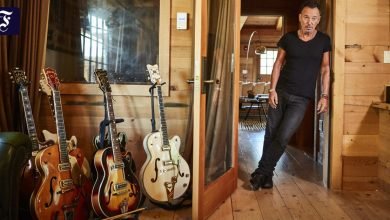CDU Landesvorsitzender Manuel Hagel will effizienteren Einsatz von künstlicher Intelligenz | ABC-Z

Der baden-württembergische CDU-Landesvorsitzende Manuel Hagel hat sich dafür ausgesprochen, für einen effizienteren Einsatz der Künstlichen Intelligenz (KI) in der Wirtschaft und der Verwaltung noch stärker in den Bau von Rechenzentren, souveräner Cloudinfrastrukturen, Speichernetzwerken sowie eine zuverlässige Stromversorgung zu investieren. KI, Bildung und der Ausbau der Infrastruktur, sagte Hagel der F.A.Z., seien die „zentralen Hebel für wirtschaftliche Stärke“. Hagel will bei der Landtagswahl 2026 Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden; er ist derzeit der Vorsitzende der Konferenz der Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU.
Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag von Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, sagte der F.A.Z., Deutschland dürfe bei KI den Anschluss nicht verpassen, die Förderung von KI sei der „entscheidende Baustein für die Zukunftsfähigkeit“ der deutschen Wirtschaft und ein Mittel zur Überwindung der „Stagnationsfalle“.
Die CDU-Politiker beraten derzeit mit dem Vorstandsvorsitzenden von BASF, Markus Kamieth, dem Vorstand für Cloud-Technologien von SAP, Thomas Saueressig, und dem Mercedes Aufsichtsratschef, Martin Brudermüller, im rheinland-pfälzischen Bad Dürkheim über wirtschaftspolitische Themen.
In den dort verabschiedeten „Hambacher Positionen zu Wirtschaft und KI“ wird außerdem gefordert, die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und die europäische KI-Gesetzgebung „praxisnah und mit Augenmaß“ auszugestalten. Dahinter verbirgt sich einerseits die Kritik an den deutschen Datenschutzbeauftragten, andererseits eine Kritik an der EU. In Deutschland haben Software-Unternehmen, die große Datenmengen nutzen wollen, es häufig mit 18 Datenschutzbeauftragten zu tun: Jedes Bundesland hat nämlich einen Datenschutzbeauftragten, Bayern sogar zwei, als 18. Beauftragte kommt die des Bundes hinzu: Louisa Specht-Riemenschneider.
Firmen, die KI-Technik entwickeln und anbieten, kritisieren auch, dass das deutsche Recht zu stark die Datenvermeidung in den Vordergrund stellt, moderne KI-Technologien – zum Beispiel in der Krebsmedizin –, benötigen aber große Datenmengen für Forschungszwecke. In dem Papier der Union wird deshalb zudem gefordert, mit öffentlichen Geldern generierte Daten auch für öffentliche Forschungszwecke nutzbar zu machen („public money, public data“). Bei der europäischen KI-Gesetzgebung (AI Act) schließen sich die Unionspolitiker der Kritik an, die häufig auch von Wirtschaftsvertretern zu hören ist: Die kritisieren häufig die strikten Dokumentationspflichten, die eng gefasste Regulierung des Datenaustausches sowie die präventive Regulierung möglicher Risiken.
Nur geteilte Zustimmung in der Wirtschaft
Mit der Forderung, noch stärker in Rechenzentren und Computer-Infrastruktur zu investieren, stoßen die Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU in der Wirtschaft allerdings nicht auf ungeteilte Zustimmung: Software-Firmen und Unternehmen, die KI-Anwendungen in Deutschland entwickeln und programmieren, weisen nämlich darauf hin, dass die entscheidende Wertschöpfung beim Programmieren der KI-Funktionen produziert wird. Statt weiterer Investitionen in Infrastruktur halten sie es für zielführender, diejenigen Firmen, die KI-Software entwickeln, mit Abschreibungsmöglichkeiten und Steuergutschriften zu fördern. Nach Auffassung von Fachleuten müsse auch die Anwendung von KI-Assistenten in der Wirtschaft und in der öffentlichen Verwaltung noch stärker gefördert werden. Wichtiger als der weitere Aufbau von Infrastruktur sei die Anwendung.
In dem Forderungspapier der Unionspolitiker wird auch dieses Problem zumindest angesprochen: „Durch den Einsatz generativer KI kann es gelingen, in einem Bruchteil der Zeit, die Menschen benötigen würden, Muster zu erstellen und damit Forschung und Entwicklung zu beschleunigen. Um diesen rasanten Fortschritt zu unterstützen und voranzutreiben, braucht es Fördersystematiken, die eben nicht bei Start Ups enden, sondern auch Mittelstand und Handwerk sowie die Landwirtschaft mit in den Blick nehmen.“
Die Unionspolitiker reagieren indirekt auch auf die jüngste Ankündigung des niederländisch-luxemburgischen Konzerns „ArcelorMittal“, keine Produktion von grünem Stahl mehr anzustreben. Die Reduktion von CO2-Emissionen müsse künftig über „marktwirtschaftliche Anreize“ erfolgen, und die Grenzausgleichsmechanismen für CO2-Emissionen in der Europäischen Union müssten weiterentwickelt werden. Nach den Regeln des „Carbon Border Adjustment Mechanism“ (CBAM) müssen nämlich Firmen, die mit CO2-Emissionen produzierte Waren einführen und verwenden, Ausgleichszahlungen leisten. Nach Auffassung von CDU und CSU müsse aber künftig die Investitionssicherheit wieder stärker betont werden, was vermutlich nur mit Abstrichen beim Klimaschutz zu erreichen wäre.