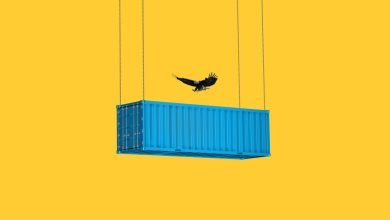Caren Miosga in der TV-Kritik: Merz „kann auch Emotionen“ | ABC-Z

Wenn der amerikanische oder französische Präsident dem Volk seine Politik erklären möchte, hält er eine Fernsehansprache zur besten Sendezeit, in der viel von patriotischen Tugenden die Rede ist und die stets mit denselben Pathosformeln endet: „God bless you all!“, „Vive la République! Vive la France!“ Wenn der deutsche Kanzler dem Volk seine Politik erklären möchte, geht er in eine Talkshow, und der höchste Ausdruck seiner amtlichen Würde besteht in dem Privileg, dort der einzige Gast zu sein.
Insofern durfte Friedrich Merz es als Vorzeichen seiner nahenden Kanzlerschaft werten, dass er die Bühne an diesem Sonntagabend bei Caren Miosga eine Stunde lang mit niemand anderem als mit der Moderatorin selbst teilen musste. Wenige Tage nach der Verkündung des Koalitionsvertrags galt es, die Deutschen von dessen Veränderungspotential zu überzeugen. „Geht so Ihr Politikwechsel, Herr Merz?“, wollte schon die Titelfrage vom Kanzler in spe wissen.
Merkels “beschönigende Rückschau“
Ganz in diesem Sinne etablierte sich denn auch bald das Muster der Sendung. Eine gut vorbereitete Miosga (dieses Mal im goldenen Hosenanzug) konfrontierte Merz mit seinen weitreichenden Versprechungen aus der Zeit vor der Wahl; Merz (Button-down-Hemd ohne Krawatte) bemühte sich zu beweisen, dass der Koalitionsvertrag diese fast vollständig erfülle. Beim ersten Thema – natürlich Migration – wartete Merz noch nicht einmal Miosgas Frage nach dem Einspieler ab; sofort betonte er, seine Ankündigung, vom ersten Tag an illegal Einreisende zurückzuweisen, stehe „fast wörtlich so“ im Koalitionsvertrag. Auf eine hermeneutische Annäherung an das Wort „Abstimmung“ wollte er sich indes nicht einlassen (bedeuten Zurückweisungen „in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn“ eher Zurückweisungen „bei deren Zustimmung“ oder auch „per Anordnung“?).
Dafür nahm er sich die Freiheit, Angela Merkel eine „beschönigende Rückschau“ auf ihre eigenen Intentionen zu bescheinigen, anstatt ihre Zustimmung zum neuen Migrationskurs erfreut zu begrüßen. Wenn der Bruch mit der früheren Parteilinie so öffentlich zelebriert wird, kann man daran wohl ermessen, wie groß das Bedürfnis nach einer Politikwende selbst innerhalb der Union ist. Anders als Merkel während ihrer Kanzlerschaft formulierte Merz zumindest auf Nachfrage hin auch eine Art Obergrenze für Asylbewerber: „keine sechsstellige Zahl“.
Was soll schon ein großer Wurf sein?
Beim Thema „Wirtschaft“ machte Merz einen guten und charakteristischen Punkt. Als Miosga wissen wollte, ob die vielen kleinen Einzelmaßnahmen schon die versprochene „Wirtschaftswende“ bedeuteten, erlaubte er sich die Gegenfrage, welches Projekt denn der „große Wurf“ sein solle. In der Tat darf man zumindest die nicht parteigebundenen Kritiker des Koalitionsvertrags fragen, welche visionäre Maßnahmen sie in den Wahlprogrammen von Union und SPD entdeckt hatten, die sie nun angeblich vermissten. Nachdem die vergangene Regierung vollmundig mit dem Versprechen angetreten war, das Fortschrittsbewusstsein zurück nach Deutschland zu bringen, mag zupackender Pragmatismus zunächst der richtige Ansatz für die neue Koalition sein. Um Visionen können sich derweil die Intellektuellen kümmern.
Auf ähnliche Weise wies der künftige Kanzler immer wieder Miosgas Wunsch zurück, Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag zu garantieren oder zu präzisieren. Ob bei den Steuersenkungen für kleine und mittlere Einkommen, dem Klimageld oder Zielvorgaben beim Bauen: Merz wollte „keine Versprechungen machen, die wir nicht erfüllen können“, lieber etwas besser als angekündigt sein „als, wie in der vorherigen Regierung, ständig den eigenen Ansprüchen hinterherzulaufen“. Auch das ist keine schlechte Idee – nur hofft man, dass am Ende nicht die Mehrzahl der Vorhaben mit der Begründung abgeräumt werden, diese hätten ohnehin immer unter Finanzierungsvorbehalt gestanden.
Mimik und Gestik aus der alten Bundesrepublik
Die entscheidenden Erkenntnisse der Sendung betrafen folglich nicht die Deutung politischer Maßnahmen, sondern den Stil des künftigen Kanzlers und seiner Regierung. Wenn Donald Trump zuletzt häufig mit römischen Herrschern wie Caesar, Caligula oder Nero verglichen worden ist, so erinnerte Merz nicht nur wegen seiner markanten Stirnfalten an Kaiser Vespasian (69-79 n. Chr.), der spät und unerwartet die Herrschaft erlangte, sich ein bewusst strenges Bildnis zulegte, zur Sanierung der Staatsfinanzen nicht vor unpopulären Maßnahmen zurückschreckte, mit Baumaßnahmen die Wirtschaft ankurbelte und fehlendes Charisma durch Tatendrang kompensierte. Wie Vespasian scheint Merz etwas aus der Zeit gefallen: Sein kerniges Auftreten, seine ganze Mimik und Gestik verraten die alte Bundesrepublik, in der er als vielleicht letzter Kanzler noch sozialisiert wurde. Doch wie bei Vespasian muss das in einer Zeit, die zunehmend zum Konservativen zu neigen scheint, nicht unbedingt ein Nachteil sein.
Ausschließlich rational und pragmatisch wollte Merz dabei aber nicht wirken. In Abgrenzung zu seinen stets besonnenen Vorgängern nahm er für sich vielmehr die Fähigkeit in Anspruch, Menschen auf einem schwierigen Weg mitnehmen zu können, sie zu überzeugen und zu begeistern: „Ich kann auch Emotionen!“ Denn: „Ein bisschen Selbstbewusstsein, ein bisschen Pathos, gesundes Nationalbewusstsein, Patriotismus – das muss doch in Deutschland auch möglich sein.“ Das klang dann fast wie die Rede an die Nation eines amerikanischen oder französischen Präsidenten – oder eben eines römischen Kaisers.