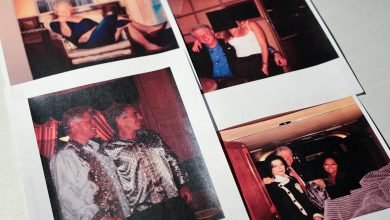Bürgermeister über sein Ehrenamt: „Die Bürokratie nervt“ | ABC-Z

taz: Herr Tiedemann, Sie sind seit 2018 Bürgermeister von Lägerdorf. Wann wollten Sie den Job das letzte Mal hinschmeißen?
Jürgen Tiedemann: Oh, das ist eine schwierige Frage! Schon das eine oder andere Mal. Es gibt so Momente, da fragt man sich: Warum tust du dir das an? Ich mache das schließlich ehrenamtlich, es ist meine Freizeit. Wenn dann eine Herausforderung, so heißt das heute ja, nach der anderen kommt, denkt man manchmal: lasst mich in Ruhe, ich gehe.
taz: Und wie schaffen Sie es, doch dazubleiben und weiterzumachen?
Tiedemann: Weil es natürlich auch immer wieder sehr positive Momente gibt, in denen etwas klappt und wir Dinge voranbringen. Man hat schließlich eine Verpflichtung gegenüber seiner Kommune und vor allem der Bevölkerung. Und ich bin so ein Typ, der immer etwas machen und entwickeln will.
Im Interview: Jürgen Tiedemann
Der Mensch
Jürgen Tiedemann ist 1952 in Lägerdorf in Schleswig-Holstein geboren und seit 2018 ehrenamtlicher Bürgermeister des Ortes. Der gelernte Banker ist verheiratet, hat zwei Kinder und zwei Enkelkinder.
Der Ort
Lägerdorf wurde im 13. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. 2025 feierte der Ort, der im Kreis Steinburg unweit von Hamburg liegt, sein 725-jähriges Bestehen. Im 18. Jahrhundert wurde die Kreide entdeckt, die unter der Gemeinde liegt. Es handelt sich um Reste des urzeitlichen Kreidemeeres, aus denen die weißen Felsen in Rügen und die Klippen von Dover stammen. Seit 1860 wird die Kreide in großem Maßstab abgebaut. Heute gehört die wichtigste Fabrik dem Schweizer Konzern Holcim.
taz: Lägerdorf ist 725 Jahre alt, war die meiste Zeit ein Bauerndorf, ist aber seit 1860 ein Industriestandort. Heute leben hier 2.740 Einwohner:innen aus fast 40 Nationen. Ist Lägerdorf eigentlich Stadt oder Land?
Tiedemann: Der Ort bietet sehr vieles – Ärzte, Apotheke, Läden, Restaurants, Tankstelle, soziale Infrastruktur von Kita über Schule bis Seniorenheim. Menschen aus den Nachbargemeinden kommen zum Einkaufen her. Trotzdem sind wir keine Stadt. Aber auch kein klassisches Dorf. Ich würde sagen, wir haben einen eigenen Status. Eine Dorfstadt vielleicht.
taz: Die besondere Geschichte von Lägerdorf hängt mit der Kreide zusammen, die hier im Boden steckt. Entdeckt wurde sie 1740, im 19. Jahrhundert begann der Abbau im großen Stil. Heute steht hier eine Zementfabrik des Unternehmens Holcim, direkt am Ortsrand klaffen gewaltige Gruben. Was macht das mit einem Ort?
Tiedemann: Die Industrie war ein Segen – aber auch eine Belastung, früher noch mehr als heute. Lägerdorf wurde der „graue Ort“ genannt, weil der Kreidestaub sich auf alles legte.
taz: Haben Sie das noch erlebt?
Tiedemann: Ja, ich bin Jahrgang 1952, und ich kann mich noch an die alte Kreidekuhle erinnern, die Englische Grube, das war später eine Müllhalde, die mit allem möglichen Abfall gefüllt wurde. Mein Onkel hat in der Zementfabrik gearbeitet, und wenn er am Wochenende Dienst hatte, brachten wir Kinder ihm das Mittagessen ins Werk. Und ich erinnere mich an die Äpfel, die wir vom Baum klauten – die waren grau von Zement und hinterließen einen Belag auf den Zähnen.
Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.
taz: In nächster Zeit fällt eine Entscheidung, die das Schicksal des Ortes für vermutlich weitere 100 Jahre bestimmt: Holcim will auf dem Gelände „Moorstücken“, heute eine Wald- und Wiesenfläche, eine weitere Grube anlegen. Sie und Ihre Gemeindevertretung müssen so einem Projekt zustimmen oder eben nicht. Wie schlecht schläft man vor so einer Entscheidung?
Tiedemann: Bei der grundsätzlichen Frage haben wir als Gemeinde keinen großen Einfluss mehr. Das Gelände steht als Kreideabbaugebiet im Regionalplan des Landes, daher hat der Antrag von Holcim Vorrang. Über die Details müssen wir mit Holcim eine vernünftige Einigung finden, die beiden Seiten zugute kommt. Wir leben seit 160 Jahren mit der Kreide, ich stehe dem weiteren Abbau nicht negativ gegenüber. Aber ich sehe es sehr kritisch, dass Dinge über unseren Kopf hinweg entschieden werden. Nur ein Beispiel: Wir hatten mit Holcim vereinbart, dass das Unternehmen uns beim Tausch oder Kauf von Flächen für Gewerbe oder Wohnraum entgegenkommt. Im Regionalplan fehlte dieser Punkt, und wir mussten ihn wieder reinverhandeln. Denn es ist entscheidend für uns: An einem Rand des Ortes liegen die alten Gruben, auf der anderen Seite soll die neue Grube entstehen, auf der dritten Seite ist Wald. Aber wir brauchen Platz für unsere Entwicklung.
taz: Lägerdorf fehlt es an Wohnraum?
Tiedemann: Wohnraum und Gewerbeflächen. Wir haben unser letztes Wohnbaugebiet im Jahre 1998 ausgewiesen, und das ist für eine Ortsentwicklung absolut negativ. Ohne junge Leute wird es schwierig, auch für die soziale Infrastruktur, was Feuerwehr, Vereine und so weiter angeht. Eine weitere Herausforderung stellt der hohe Altbaubestand dar, frühere Werkswohnungen, die mit 40 bis 50 Quadratmetern für heutige Bedürfnisse zu klein sind und dadurch zu einer starken Fluktuation der Mieter führen. Zurzeit versuchen wir, die wenigen im Innenbereich zur Verfügung stehenden Flächen wohnwirtschaftlich sowie gewerblich zu entwickeln.
taz: Wozu weiteres Gewerbe, bringt Holcim nicht ausreichend Arbeit?
Tiedemann: Früher lebten die meisten der über 1.000 Beschäftigten in Lägerdorf, heute sind es rund 320. Und wenn heute Spezialisten wie Ingenieure et cetera eingestellt werden, pendeln die meistens aus Hamburg oder der weiteren Umgebung. Ein Grund dafür ist auch der fehlende qualifizierte Wohnraum.
taz: Ist die Fabrik eher Teil der Gemeinde oder ein Fremdkörper?
Tiedemann: Früher hieß es immer „meine Fabrik“, ein ganzes Dorf hat quasi von und mit der Fabrik gelebt. Aber davon sind wir heute weit entfernt. Ich mache den Verantwortlichen vor Ort keinen Vorwurf, die unterstützen uns schon im Bereich ihrer Möglichkeiten. Wenn zum Beispiel im Freibad etwas repariert werden muss, springt Holcims Lehrwerkstatt ein. Aber die großen Entscheidungen werden woanders getroffen. Holcim ist nun mal ein Schweizer Konzern, der Geld verdienen will – das ist unsere globale Wirtschaft.
taz: Man sollte denken, dass so eine Fabrik Millionen in die Gemeindekasse spülen würde. Der geplante Haushalt für 2024 schloss allerdings mit einem Minus 1,9 Millionen ab. Wie kann das sein?
Tiedemann: Tatsächlich haben wir durch gutes Wirtschaften das Minus auf 1,2 Millionen Euro gedrückt, aber die Summe bleibt beträchtlich. Wir kriegen von Holcim zurzeit so gut wie keine Gewerbesteuer, und wenn Geld fließt, dann geht ein Teil an die Nachbargemeinde, weil die Fabrik auch dort Flächen besitzt. Zuletzt mussten wir sogar einen Großteil der bereits erhaltenen Gewerbesteuern zurückzahlen, weil sich die wirtschaftliche Situation verändert und das Unternehmen Investitionen in die Zukunft getätigt hat. Zurzeit plant Holcim einen neuen Ofen, der dazu führen soll, dass in Lägerdorf das weltweit erste CO2-freie Zementwerk entstehen soll. Mal sehen, ob es so kommt! Das verursacht natürlich immense Kosten. Das Unternehmen kann – auch dank des Investitionsprogramms der Bundesregierung – hohe Abschreibungen geltend machen. Die Gemeinden haben wieder einmal das Nachsehen.
taz: Sie sind, wie schon erwähnt, ehrenamtlich tätig. Ist das überhaupt leistbar, bei einem Themenspektrum von Asiatischer Hornisse, die im Sommer in Lägerdorf entdeckt wurde, bis Zement?
Tiedemann: Ich glaube, zeitlich ist das ein Fulltimejob. Wir sind hier gut strukturiert – ich habe zwei Stellvertreter, die viele Aufgaben mit erledigen. Eigentlich bräuchten wir einen hauptamtlichen Bürgermeister, aber mit dem Haushaltsminus sind wir eh schon Fehlbedarfsgemeinde, und wie sollen wir einen hauptamtlichen Bürgermeister bezahlen? Man muss sich fragen, ob die derzeitige Struktur noch so passt.
taz: War Ihnen vorher klar, was dieses Amt alles so mit sich bringt?
Tiedemann: Ja, ich war vorher schon in der Gemeindevertretung. Und mein Ziel war und ist es, unser Dorf nach vorne zu bringen. Die Folge daraus war, dass ich mit meinen Stellvertretern und der Gemeindevertretung diverse neue Projekte angepackt habe. Also selber schuld, kann man sagen. Aktuell ist der Plan, nur noch ein Projekt pro Jahr umzusetzen und erst einmal nichts Neues anzufassen. Aber dann kam das Konjunkturpaket des Bundes, da müssen wir natürlich gucken, dass davon hier etwas ankommt.
taz: Sie sind CDU-Mitglied, treten aber für die Wählergemeinschaft „Gemeinsam für Lägerdorf“ an, die bei der jüngsten Kommunalwahl über 50 Prozent bekam. Warum ziehen solche Bündnisse mehr als klassische Parteien?
Tiedemann: Wahrscheinlich findet sich der Bürger in den Parteien nicht wieder. Eine Wählergemeinschaft will vor Ort etwas bewegen und verfolgt damit andere Interessen und Ziele. Wir haben mehrere Parteien im Gemeinderat, aber wir hatten immer das Ziel, gemeinsam zu entscheiden, zu entwickeln und unser Dorf voranzubringen. Das kriegen wir zurzeit sehr vernünftig hin.
taz: Die AfD ist nicht im Gemeinderat vertreten?
Tiedemann: Nee, die haben wir nicht im Ort. Bei der letzten Kommunalwahl war die AfD kein Thema. Aus heutiger Sicht kann ein Grund dafür sein, dass die Leute sehen, dass wir uns immer sofort kümmern, wenn etwas nicht läuft. Und wenn es sich nicht erledigen lässt, sagen wir das auch. Aber, das muss man auch sagen: Die Bürokratie nervt. Allein die Planung für das Dorfgemeinschaftshaus dauert schon vier Jahre. Endlich hatten wir eine Baugenehmigung, aber dann muss plötzlich ein Schallgutachten erstellt werden. Statt den Heizungsbauer vor Ort zu beauftragen, müssen wir die Arbeit aufwändig ausschreiben. Ich soll besser wirtschaften, aber wenn ich keine Kohle habe und solche Auflagen erfüllen muss, wie soll ich das machen?
taz: In vielen Gemeinden treten Kommunalpolitiker:innen zurück oder es finden sich keine, teils aus Angst vor Anfeindungen, teils wegen der Anspruchshaltung vieler Leute, „die da oben“, und das meint eben auch schon Ehrenamtliche, sollten sich um alles kümmern. Wie läuft das in Lägerdorf?
Tiedemann: Wie gesagt, wir versuchen, alle Herausforderungen von uns aus zu lösen. Ein bisschen lustig ist, wenn Leute anrufen und sich beschweren, weil die Truppe vom Bauhof Äste sägt oder Laub wegpustet. Sprich, sie ärgern sich, weil die Gemeinde etwas tut. Da muss man sagen, dass das nun mal nicht anders geht. Insgesamt passen die Strukturen aber. Im Ort gibt es viele Vereine und mehrere sehr aktive Fördervereine, für das Freibad, das Museum, die Schule mit ihrem „Gesunden Frühstück“ oder Unterstützung des Fußballsports. Freiwillige organisieren Feiern oder schmieren Brote für das Schulfrühstück. Unser TSV, der Shanty-Chor, die Chorfreunde und der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr sind weit über die Ortsgrenzen bekannt. Es gibt Treffs für Neubürger und Senioren. Wir schaffen auch Integration, wir haben viele Migranten aufgenommen – mit viel ehrenamtlicher Unterstützung aus dem Ort, die bis heute anhält. Diese Angebote könnten wir als Gemeinde nicht stemmen. Dieses Gemeinsame macht mich stolz und froh.
taz: Wie und warum sind Sie überhaupt in die Kommunalpolitik gegangen?
Tiedemann: „Mein größter Fehler“, sage ich immer, und es war ein bisschen kurios. Ich bin in Lägerdorf geboren – übrigens ganz buchstäblich, als Hausgeburt auf dem Küchentisch. Das war damals, Anfang der 1950er Jahre, gar nicht so ungewöhnlich. Es war ein harter Winter, kurz vor Weihnachten, meine Mutter waren die acht Kilometer zum Krankenhaus in Itzehoe zu weit. Jedenfalls war ich als Kind schon im TSV Lägerdorf, erst beim Turnen, dann beim Fußball, und wurde in jungen Jahren Vorsitzender des Vereins. Wir brauchten einen neuen Sportplatz, und die CDU sagte: Wir unterstützen dich, aber dafür musst du bei uns eintreten. Ich habe Ja gesagt. Wir bekamen den Sportplatz – und ich bin seither in der Gemeindepolitik und habe eine Aufgabe nach der anderen an die Ohren bekommen.
taz: Was wollen Sie als Bürgermeister noch erreichen?
Tiedemann: Wir haben in den gemeindlichen Gremien ein Ortsentwicklungskonzept entwickelt, das umgesetzt werden muss – und das geht über meine Amtszeit hinaus. Konkret möchte ich ein kommunales Industriegebiet zusammen mit den Nachbargemeinden voranbringen. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist die Entwicklung und Umsetzung der lange vernachlässigten Wohnbauentwicklung. Über einen Mangel an Aufgaben kann ich mich nicht beklagen! Wir wollen Grundlagen für die Zukunft schaffen.
taz: Stichwort Zukunft: Zement und Beton sind alles andere als umweltfreundliche Stoffe. Der Abbau hinterlässt tiefe Gruben, Umweltgruppen warnen vor einer Versalzung der Flüsse. Vor allem braucht die Herstellung von Beton viel Energie. Macht Ihnen das keine Sorgen?
Tiedemann: Holcim hat in Aussicht gestellt, in Lägerdorf und Rethwisch eine der weltweit ersten klimaneutralen Zementfabriken zu bauen. Wenn wir vom Stand heute ausgehen und dieser Plan gelingt, ist das für uns positiv, dann hat die Fabrik Zukunft. Arbeitsplätze sind gesichert oder entstehen neu. Und vielleicht bekommen auch die Kommunen wieder etwas vom Kuchen – sprich Gewerbesteuer, ab. Ja, es gibt negative Seiten, aber wenn wir nur darauf schauen, kommen wir nicht voran. Wir können solche Fabriken nicht nur in anderen Ländern haben wollen, sondern müssen über unseren Schatten springen und es mittragen. Wer weiß, was sich noch entwickelt. Vielleicht wird man einen Weg finden, um CO2 zu nutzen, statt es zu verpressen. Es könnte ein neuer Rohstoff werden, und wenn der hier entsteht, warum nicht?
taz: Wir haben vorhin davon gesprochen, dass Sie das Amt schon mal vorzeitig hinschmeißen wollten. Machen Sie sich Gedanken darüber, ob Sie überhaupt einen Nachfolger finden, wenn Sie den Posten abgeben wollen?
Tiedemann: Ich bin jetzt 73 Jahre alt und habe noch zweieinhalb Jahre in der laufenden Legislaturperiode vor mir. Wenn ich nicht weitermachen möchte, finden wir im Team eine Lösung, da bin ich mir ganz sicher. Aber ja, es ist ein riesiges Problem, dass sich junge Menschen nicht mehr so stark ehrenamtlich betätigen wollen, weder in Vereinen noch in der Kommunalpolitik. Schließlich geht es um deren Zukunft – was wir jetzt entscheiden über Holcim, über die Industrie- und Wohngebiete im Ort, das betrifft die Jungen viel mehr als uns Ältere. Vielleicht sagt Lägerdorf irgendwann: Leider haben wir niemanden mehr, der es macht. Dann braucht es einen Hauptamtlichen, aber wie der finanziert werden soll, das weiß ich auch nicht.