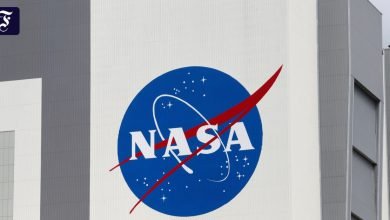Brosius-Gersdorf und die Aufgaben der Verfassungsrichter | ABC-Z

Gegen Frauke Brosius-Gersdorf wurden in den vergangenen Wochen viele Vorwürfe erhoben. So wurde der Staatsrechtlerin vorgehalten, sie vertrete Positionen, die der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts widersprächen. Dabei ging es etwa um den Schwangerschaftsabbruch. Doch eignet sich solch eine Feststellung von Differenzen – abgesehen von der Ungenauigkeit vieler Darstellungen –, um der von der SPD vorgeschlagenen Kandidatin die Fähigkeit zum höchsten Richteramt abzusprechen?
Bislang ist Brosius-Gersdorf Wissenschaftlerin. Sich in dieser Rolle kritisch mit der Rechtsprechung auseinanderzusetzen, ist nicht skandalös. Kritik ist der Wissenschaft immanent. Und nicht einmal Urteile des Bundesverfassungsgerichts sind sakrosankt. Niemand, der nach Karlsruhe gewählt wird, ist verpflichtet, alle Entscheidungen gutzuheißen, die das Gericht in seiner wechselvollen Geschichte gefällt hat. Mit ihrer Kritik an der bisherigen Rechtsprechung zum Schwangerschaftsabbruch steht Brosius-Gersdorf auch nicht allein da. Man muss ihre Positionen deshalb nicht teilen. Allein ihre kritische Auseinandersetzung mit der bestehenden Regelung delegitimiert die Juristin aber nicht für das Richteramt.
Ein völlig anderer Beruf
Bei Markus Lanz wies die Staatsrechtlerin am Dienstagabend selbst auf den Rollenwechsel hin, den jeder neue Verfassungsrichter vollziehen muss. Wenn man aus der Wissenschaft nach Karlsruhe wechsele, sei das ein Berufs- und Rollenwechsel, den man ernst nehmen müsse, sagte Brosius-Gersdorf. Als Wissenschaftlerin beschäftige sie sich etwa mit Themen, die sie selbst aussuche. Sie halte es auch für wichtig, aktuelle politische und rechtliche Fragen aufzugreifen. Für eine wesentliche Aufgabe von Wissenschaftlern halte sie es außerdem, eine Brücke zur Praxis zu schlagen und Verbesserungsvorschläge zu machen.
Am Verfassungsgericht sei die Arbeit eine andere. Das gelte schon deshalb, weil man als Mitglied eines Kollegialorgans entscheide: als eines von acht Mitgliedern eines Senats, der eine Mehrheit finden müsse. Es gehe zwar auch für einen Verfassungsrichter um die Auslegung des Grundgesetzes; das sei aber ein völlig anderer Beruf.
Bei Richtern, die nach Karlsruhe gehen, ist der Rollenwechsel, den Brosius-Gersdorf beschreibt, geringfügig. Bei Wissenschaftlern ist er schon erheblicher. Vor die größte Herausforderung sind allerdings Politiker gestellt. Stand so ein Wechsel in der Vergangenheit an, gab es deshalb immer Diskussionen – die allerdings nie dazu führten, dass ein Vorschlag des Wahlausschusses keine Mehrheit im Parlament fand.
Von der Unionsfraktion an die Spitze des Verfassungsgerichts
Eine intensive Debatte gab es etwa, als Stephan Harbarth Verfassungsrichter wurde. Er war davor fast zehn Jahre lang Mitglied der Unionsfraktion im Bundestag und gehörte seit 2016 deren Vorstand an. Harbarth galt dort als seriöser Strippenzieher. Auch er hat den Rollenwechsel geschafft. Heute ist er Präsident des Verfassungsgerichts.
Nicht einmal die Tatsache, dass er als Parlamentarier an einem Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen mitgearbeitet hatte, das dem Gericht später zur Prüfung vorlag, schien seinem Senat größere Sorgen zu bereiten. Harbarth selbst bat seine Kollegen damals um eine Entscheidung darüber, ob bei ihm die Besorgnis der Befangenheit bestehen könnte. Er erklärte, als Bundestagsabgeordneter „intensiv in die Vorbereitung und Verabschiedung des Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen eingebunden“ gewesen zu sein. Er habe für ein Verbot geworben und den letztlich verabschiedeten Kompromiss mitgetragen. Die Mehrheit der Senatskollegen sah dennoch keinen Anlass, an Harbarths Fähigkeit zu zweifeln, unvoreingenommen seines neuen Amts zu walten.
Anders ging es einmal bei Peter Müller aus. Er war vor seiner Wahl zum Verfassungsrichter im Jahr 2011 als CDU-Politiker Ministerpräsident des Saarlands. In dieser Rolle hatte er sich intensiv für ein Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe eingesetzt. Das 2015 vom Bundestag verabschiedete Gesetz beruhte auf einem Entwurf, der weitgehend mit einem von Müller erarbeiteten übereinstimmte. Als die Regelung dem Zweiten Senat 2018 zur Prüfung vorlag, schlossen Müllers Kollegen ihn aus dem Verfahren aus.
Sie betonten, dass die bloße Mitwirkung an einem Gesetzgebungsverfahren für eine Besorgnis der Befangenheit zwar nicht ausreiche. Es bedürfe vielmehr weiterer Umstände, die eine besonders enge Beziehung zur verfassungsmäßigen Prüfung geschaffen hätten. Die lägen hier vor. Zugleich hoben sie hervor, dass es nach den Bestimmungen über die Wahl von Verfassungsrichtern selbstverständlich und sogar erwünscht sei, auch solche Kandidaten zu ernennen, die vorher politische Funktionen ausgeübt oder Regierungsämter bekleidet hätten.
Dass die Karlsruher Rollenwechsel in der Vergangenheit gelangen, zeigte sich auch darin, dass Richter etwaige Erwartungen nicht erfüllten. Wer sich beispielsweise erhofft hatte, dass Richter, die auf Vorschlag von SPD oder Grünen gewählt wurden, den Nachtragshaushalt der Ampelkoalition billigen würden, wurde enttäuscht. Gleiches gilt für den Klimabeschluss oder die Aufhebung des Verbots der geschäftsmäßigen Sterbehilfe.
Auch hierin kommt zum Ausdruck, dass sich Wahlen an ein Gericht und in ein Parlament wesentlich unterscheiden. Wer zu einer politischen Wahl antritt, macht das mit der Zusage, seine Positionen auch umzusetzen. Wer an das Verfassungsgericht gewählt wird, weiß, dass solche Versprechungen deplatziert sind.