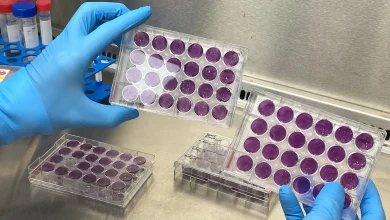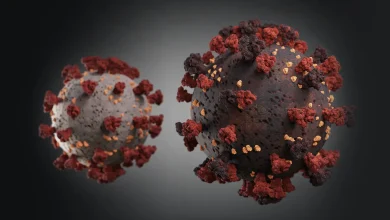Bouldern gegen Depression: So gesund ist therapeutisches Klettern | ABC-Z

Stand: 27.10.2025 10:53 Uhr
| vom
Bouldern und Klettern sind gesund für Psyche und Körper: Angst überwinden, Selbstvertrauen steigern, Muskeln aufbauen – gerade auch im Rücken. Und: Der Sport hilft bei Depressionen wie eine Verhaltenstherapie.
Beim Klettern und Bouldern sind Bewegungen gefordert, die an die Kindheit erinnern – eine Zeit, die für viele Menschen besonders motivierend ist. Das machen sich Klettertherapeutinnen und -therapeuten zunutze und setzen die Bewegungstherapie zur Prävention, Behandlung und Rehabilitation ein. Therapeutisches Klettern kommt in der Orthopädie, Neurologie, Psychologie oder Kinderheilkunde zur Anwendung.
Klettern und Bouldern haben gesunde Wirkung
Klettern und Bouldern haben viele gesunde und positive Effekte auf den Körper. Das Ganzkörpertraining fördert vor allem:
- Kraft und Körperspannung
- Gleichgewicht
- Koordination
- Beweglichkeit und Stabilität der Gelenke, Sehnen, Bänder
- Körperflexibilität durch fließende Körperbewegungen und muskuläre Anspannung
Muskulär beansprucht werden vor allem Finger und Unterarme, außerdem der Rumpf, der obere Rücken, die Schultern, Beine und Po.
Klettern trainiert Muskeln, Bänder und Sehnen
Bei orthopädisch-traumatologischen Verletzungen, wie zum Beispiel einem Bänderriss oder Rückenbeschwerden kann Klettern helfen – ob als Seilklettern oder Bouldern. Gleiches gilt für chronische Beschwerden des Bewegungsapparates. Therapeutisches Klettern wird vor allem für die Körperbereiche Wirbelsäule, Hüfte, Knie und Fuß eingesetzt.
Der gesamte Körper bewegt sich während des Trainings beim Klettern oder Bouldern. Dies bedeutet auch ein effektiveres Krafttraining als bei einfachen Bewegungen. Die Teilnehmenden müssen sich auf bestimmte Muskeln oder Muskelgruppen konzentrieren, geschädigte oder geschwächte Bereiche passen sich an. Der gesamte Bewegungsapparat muss dreidimensional funktionieren – Bänder, Sehnen oder Muskeln arbeiten mit und werden trainiert.
Die Muskulatur des Rumpfes und der Wirbelsäule wird durch die diagonalen Bewegungen und die Kombination aus Druck und Zug besonders gestärkt. Auch bei Rückenschmerzen lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Schmerzen zu verstehen und schmerzbedingte Angst und Vermeidung zu reduzieren.
Klettern und Bouldern: Gut für die Psyche und gegen Depression
Klettern oder Bouldern kann auch bei verschiedenen psychischen Erkrankungen helfen – wie zum Beispiel bei Depressionen oder Angststörungen, wie Forschungsergebnisse zeigen. Eingesetzt wird es auch bei Burnout, Traumata oder Erschöpfungssymptomatiken.
Dass Herausforderungen aus eigener Kraft bewältigt werden, hat positive Auswirkungen auf:
- Konzentrationsfähigkeit
- Selbstwirksamkeit
- Motivation
- Vertrauen in den eigenen Körper
Außerdem fördert das therapeutische Klettern das Verantwortungsbewusstsein, die Kommunikation und das gegenseitige Vertrauen.
So funktioniert therapeutisches Klettern oder Bouldern
Speziell ausgebildete Therapeutinnen und Therapeuten begleiten das therapeutische Klettern oder Bouldern. “Klettertherapeut” ist aber kein geschützter Begriff. Die Therapie wird einzeln oder in einer Gruppe durchgeführt. Für eine optimale Behandlung ist es wichtig, dass das therapeutische Klettern in ein Therapiekonzept mit einem interdisziplinären Team aus Ärzten und Therapeuten eingebunden ist. Übrigens: Erfahrung im Bouldern oder Klettern sind keine Voraussetzungen – den Sport lernen Teilnehmende in der Therapie.
Bouldern gegen Depressionen
Laut einer Studie des Universitätsklinikums Erlangen aus dem Jahr 2019 kann Bouldern bei einer Depression mindestens genauso wirksam sein wie eine Verhaltenstherapie. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickelten im Rahmen der Studie “Klettern und Stimmung” die sogenannte Boulderpsychotherapie. Sie verbindet das Bouldern mit Elementen aus der Psychotherapie sowie mit Achtsamkeits- und Entspannungsübungen.
Gedankenkarussell durch Fokus beim Bouldern durchbrechen
Beim therapeutischen Klettern oder Bouldern erleben Teilnehmende therapierelevante Themen direkt an der Kletterwand. So hilft allein schon die Konzentration auf eine bestimmte Route beim Bouldern dabei, pathologisches Grübeln (auch Gedankenkarussell oder Gedankenkreisen genannt) zu durchbrechen – eines der Hauptsymptome einer Depression.
In Bezug auf Angst, Körperbild, Bewältigungsmechanismen, Selbstwertgefühl und Sozialverhalten ergaben sich in der Erlanger Studie ebenfalls Verbesserungen. Denn: Menschen setzen sich beim Bouldern mit den eigenen Grenzen und Ängsten auseinander, lernen loszulassen und Vertrauen in sich und andere zu haben.
Grenzen der Bouldertherapie
Wer unter einer schweren Depression leidet, unter einer Angststörung, einer bipolaren Störung, einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung oder Suizidgedanken hat, sollte immer einen Therapeuten aufsuchen. Die Bouldertherapie kann hier ergänzen, ersetzt aber keine Therapie.
Bessere Körperwahrnehmung bei neurologischen Erkrankungen wie MS
Eine bessere Körperwahrnehmung und Koordination bei neurologischen Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Parkinson, Schädel-Hirn-Trauma oder Schlaganfall kann das therapeutische Klettern ebenfalls schaffen. Eine Studie hat 2021 die positive Wirkung des therapeutischen Kletterns bei Parkinson-Erkrankten nachgewiesen.
Älteren Menschen kann die Therapie helfen, Muskeln aufzubauen und das Gleichgewicht zu trainieren. Der Gang wird sicherer – ein wichtiger Baustein für eine Sturzprophylaxe. Zudem wird auch das Gehirn trainiert.
Aktuelle Studie: Bouldern bei Jugendlichen
Auch bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, Konzentrations- und Lernschwierigkeiten, ADS, ADHS wird therapeutisches Klettern erfolgreich eingesetzt.
Im Rahmen der aktuellen Studie “Boulder dich stark” untersuchen Forschende, inwieweit die Bouldertherapie Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren helfen kann. Wer sich gestresst oder belastet fühlt, kann sich für die Studie in Erlangen, Nürnberg, Bamberg oder Regensburg anmelden.
Therapeutisches Klettern bei aktiver Arthrose nicht ratsam
Beim Sport sollten Patientinnen und Patienten weitestgehend schmerzfrei sein. Bei Erkrankungen wie einer aktiven Arthrose raten Expertinnen und Experten vom Klettern ab. Gleiches gilt für nicht vollständig geheilte Knochenbrüche, gerade operierte Gelenke, einen frischen Bandscheibenvorfall oder wenn ungeklärte akute Schmerzen auftreten.
Vorsicht bei Osteoporose und Herzerkrankungen
Menschen, die unter Osteoporose leiden, sollten bereits vor dem Klettern oder Bouldern genügend Muskeln aufgebaut haben, damit ein plötzliches Abspringen aufgrund von nachlassender Kraft beim Klettern verhindert wird. Hier besteht sonst die Gefahr, sich einen Bruch beim Aufprall zuzuziehen oder sich sonst zu verletzten. Grundsätzlich gilt außerdem: Die Verletzungsgefahr ist beim Bouldern deutlich höher, als beim Seilklettern.
Bei Herzerkrankungen und künstlichen Gelenken sollten Betroffene zunächst ärztliche Rücksprache halten. Dies gilt ebenso bei Einnahme von Schmerzmitteln.
Unter Bouldern versteht man das Klettern ohne Seil und Gurt bis zur Absprunghöhe von rund 4,50 Metern. Aufgrund der fehlenden Sicherung kommt es beim Bouldern häufiger zu Verletzungen als beim Seilklettern – dafür braucht es keinen Partner oder Automaten zum Sichern. Auch Bouldern kann man sowohl in der Halle, wie auch am Fels. Klettern und Bouldern sind beliebt: Über eine Million Menschen in Deutschland klettern an Felsen oder in Hallen. Die Szene ist laut Deutschem Alpenverein in den vergangenen Jahren stark gewachsen.