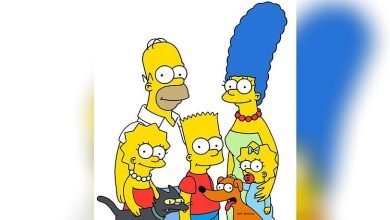Neuer ORF-Krimi: Diese Begriffe sollten Austro-Kimi-Fans kennen | ABC-Z

Der österreichische Krimi “Mord in Wien – Der letzte Bissen” wird am 24. April um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt und verspricht nicht nur spannende Unterhaltung, sondern auch eine gehörige Portion Wiener Schmäh. Zwischen Verfassungsschutz und organisierter Kriminalität bewegt sich die frisch zusammengestellte Ermittlerteam Oberstleutnant Carl-Albrecht Nassau (August Wittgenstein) und Majorin Franziska Malzer (Caroline Frank) durch die österreichische Hauptstadt.
Dabei prasselt auf das Publikum eine Welle an österreichischen Dialekt-Ausdrücken ein, die manchen deutschen Zuschauer überfordern könnte. Um dem Geschehen trotzdem folgen können, kommen hier die wichtigsten Begriffe aus dem Austro-Krimijargon, die auch beim Wien-“Tatort” (Moritz Eisner und Bibi Fellner), “Kommissar Rex”, “Die Toten von Salzburg”, “Blind ermittelt”, “Wiener Blut – Berggericht” oder den “Steirerkrimis” helfen können.
Krimibegriffe für Einsteiger
Wenn in einem ORF-Krimi die Rede von einer “Puffn” ist, ist keinesfalls ein zwielichtiges Etablissement gemeint, sondern schlicht eine Pistole. Sollte jemand einen “Taschlzieher” erwähnen, handelt es sich um einen Taschendieb. Und wer im “Häfn” landet, sitzt im Gefängnis – für Kriminelle in Österreich also gewissermaßen das Endstadium einer unrühmlichen Karriere.
Bei der Aufklärung von Mordfällen könnten die Ermittler auch auf “Gfrastsakln” stoßen – so nennt man im Wienerischen besonders unangenehme Zeitgenossen. Außerordentlich gefährlich sind natürlich “Hinicher”, also Mörder, die man besser nicht ohne “Achter” – Handschellen – laufen lässt.
Das neue Ermittlerduo
Der Auftaktfall der neuen Krimireihe führt Oberstleutnant Nassau und Majorin Malzer in die Wiener Unterwelt. Nach einem Doppelmord an zwei hohen Staatsbeamten im Wiener Wald sollen die ungleichen Ermittler herausfinden, wer hinter den Verbrechen steckt. Die beiden Opfer, Ehrlacher und März, wurden wie Wild auf einer Lichtung drapiert und damit regelrecht inszeniert. Doch schon bei der Durchsuchung der Wohnung eines der Opfer gerät Nassau ins Visier eines Angreifers mit verdächtigen Mafia-Tattoos. Und auch dem Verfassungsschutz kommen sie in die Quere…
August Wittgenstein spielt den bisexuellen und scharfsinnigen Spezialisten für unlösbare Fälle Carl-Albrecht Nassau. Der Salzburger besticht nicht nur mit Anzug oder zumindest perfekt sitzender Jacke, sondern punktet auch mit subtiler Ironie und schlagfertigen Antworten. Seine adligen Wurzeln und umfangreiche Bildung öffnen dem blaublütigen Ur-Ur-Großneffen aus einem K.u.K.-Nebenzweig Türen, die anderen verschlossen bleiben.
Caroline Frank verkörpert die bodenständige Weinbauerntochter Franziska Malzer, die mit typisch wienerischem Humor und einer Portion “Grant” (mürrischer Grundstimmung) durchs Leben geht – allerdings immer mit Leidenschaft für ihren Job. Unerschrocken und clever lässt sie sich weder von Titeln noch von Macht beeindrucken und setzt sich besonders für jene ein, die keine Stimme haben.
Vom “Filutierer” zum “Einvernehmen”
Ein besonders faszinierender Aspekt des Austro-Kriminaljargons ist seine Vielfalt an Begriffen für verschiedene Vergehen. Ein “Filutierer” beispielsweise ist ein Betrüger, während “einedrahn” so viel wie betrügen bedeutet. Sollte jemand “okrageln”, dann bringt diese Person jemanden um – ein guter Grund, um sofort den “Kieberer” (Polizisten) zu rufen. Diese sorgen dann dafür, dass der Verbrecher “eikastelt” wird – das bedeutet, ins Gefängnis kommt. Wenn die Ermittler jemanden dagegen “einvernehmen”, dann verhören sie diese Person nur… Und so sorgen die österreichischen Krimis stets auch für eine unterhaltsame Einführung in die Mundart.
“Mord in Wien – Der letzte Bissen” ist eine Koproduktion von Allegro Film mit der ARD Degeto Film für die ARD und dem ORF mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Fisa+. Die Regie führt Sabine Derflinger nach einem Drehbuch von Horst G. Fiedler.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de