Blutige Gewalt erinnert an Genozid in Ruanda – „Raserei und Freude am Töten“ | ABC-Z

Es ist ein erschütterndes Abschlachten, das sich gerade im Sudan abspielt – eines, das offenbar noch lange nicht ans Ende gekommen ist. Hilfsorganisationen klagen, die Gewalt nehme immer brutalere Formen an. Besonders im Fokus: die Großstadt Al-Faschir. 260.000 Menschen sitzen dort in der Falle ihrer Peiniger, den Milizionären von den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF).
Misshandlungen, Vergewaltigungen, Mord seien zahlreich, heißt es etwa von der Diakonie Katastrophenhilfe. Deren Präsidentin Dagmar Pruin mahnte am Mittwoch, der Krieg in dem ostafrikanischen Land müsse endlich gestoppt werden, sonst sei die humanitäre Katastrophe nicht mehr in den Griff zu bekommen und könne sich ausweiten.
Der Sudan-Gesandte des UN-Kinderhilfswerks Unicef fühlt sich von dem Grauen bereits an die blutigsten Zeiten auf dem Kontinent erinnert: den Genozid in Ruanda der 1990er Jahre. „Vieles von dem, was in Teilen des Sudans gerade passiert, erinnert mich daran. Die Berichte über die Raserei. Die Freude am Töten“, sagte Sheldon Yett dem „Spiegel“. „Es kommt zu gezielten Gewalttaten gegen verschiedene ethnische Gruppen.“
Yett fügte hinzu: „Die Berichte der Überlebenden sind erschütternd: Morde, Erpressung, Vergewaltigungen. Manche zahlen hohe Summen, um zu fliehen. Es herrscht ein völliger Zusammenbruch jeglicher Ordnung“, sagte Yett, der eigenen Angaben zufolge den Völkermord in Ruanda in den 1990er Jahren miterlebt hatte. „Der Sudan ist ein Testfeld für moderne Kriegsführung.“ Rund 20 Millionen Menschen seien von Hunger bedroht. „Unterernährung, fehlendes Trinkwasser, die fehlende medizinische Versorgung, verlorene Bildung, Traumata. Diese Narben werden eine ganze Generation prägen“, so Yett.
Seit April 2023 gibt es wieder Krieg im Sudan – zwischen RSF und Armee. In dem Machtkampf geht es unter anderem um die Kontrolle über Sudans Gold- und Ölvorkommen. Zehntausende Menschen wurden getötet, fast zwölf Millionen weitere vertrieben. In dem Land herrscht nach UN-Angaben die schlimmste Hungerkrise weltweit.
Dieses von UNICEF veröffentlichte Foto zeigt vertriebene Kinder und Familien aus Al-Faschir in einem Flüchtlingslager.
© Mohammed Jammal/UNICEF/AP/dpa | Mohammed Jammal
Ethnische Gewalt im Sudan: „Sie töten dich sofort“
Arun Harun hat miterlebt, wovon Yett und die Diakonie sprechen: Als die RSF-Milizionäre in Al-Faschir einrückten, erschossen sie ihren Mann und ihren ältesten Sohn, direkt vor ihren Augen. „Wir wollen euch hier nicht“, hätten die Mörder ihr Tun begründet. Sie selbst entkam, schilderte sie der Nachrichtenagentur AFP das Erlittene.
Die Gewalt im Sudan entzündet sich entlang ethnischer Trennlinien. In Darfur leben mehrere nicht-arabische ethnische Gruppen, darunter die Zaghawa, Fur, Berti und Masalit. Sie werden seit langem von arabischen Milizen verfolgt. Der RSF gehören tausende ehemalige Kämpfer der berüchtigten arabischen Dschandschawid-Miliz an, die des Völkermordes in Darfur vor zwanzig Jahren beschuldigt wird. Zwischen 2003 und 2008 wurden dort schätzungsweise 300.000 Menschen getötet und fast 2,7 Millionen Einwohner vertrieben. Jetzt, so scheint es, setzen sie ihre Jagd auf die nichtmuslimische schwarze Bevölkerung fort, bislang weiterhin ungehindert.
„Sie beurteilen dich nach deinem Stamm, deiner Hautfarbe und der Herkunft deiner Familie“, weiß Hassan Osman. Dem Studenten gelang kürzlich die Flucht in die Stadt Tawilia. Dort berichtet er der AFP: „Wenn du bestimmten Stämmen angehörst, stellen sie keine Fragen, sondern töten dich sofort.“ Je nach Stammeszugehörigkeit hätten die Milizionäre von den flüchtenden Zivilisten auch Geld erpresst, oft Hunderte Dollar, sagt Osman. „Sie fragen, woher deine Familie stammt, und legen den entsprechenden Betrag fest.“

Flucht im Sudan: Extreme Lebensgefahr
Insbesondere Menschen vom Stamm der Zaghawa seien auf der Flucht „rassistisch beleidigt und gedemütigt worden“ und hätten „psychische und körperliche Gewalt“ erlitten, berichtet Osman. Die Zaghawa sind die dominierende ethnische Gruppe in Al-Faschir und kämpfen seit Ende 2023 an der Seite der Armee. Auch Amna Harun, deren Mann und Sohn erschossen wurden, ist eine Zaghawa.
Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
Hinter den Kulissen der Politik – meinungsstark, exklusiv, relevant.
Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der
Werbevereinbarung
zu.
Osman hingegen gehört dem Stamm der Berti an und blieb unbehelligt. Doch was er mitansehen musste, war schrecklich: Die Straßen von Al-Faschir seien „mit Leichen übersät“ gewesen, schildert Osman. „Manche wurden von Hunden gefressen.“
Der 16-jährige Munir Abderahman brauchte elf Tage, um von Al-Faschir in das Lager Tiné im Nachbarland Tschad zu fliehen. Als die RSF-Miliz Ende Oktober in Al-Faschir einmarschierte, pflegte Munir gerade seinen Vater im Krankenhaus, einen Soldaten der regulären Armee, der einige Tage zuvor bei den Kämpfen verletzt worden war.

„Die Milizionäre riefen sieben Krankenschwestern zusammen und führten sie in einen Raum. Wir hörten Schüsse und ich sah das Blut unter der Tür hindurchsickern“, erzählt er mit brüchiger Stimme. Noch am selben Tag verließ der Jugendliche mit seinem Vater die Stadt, doch der Vater starb auf der Flucht.
Die, denen die Flucht aus Al-Faschir gelungen sei, zeigten dabei oft Anzeichen extremen Hungers, erklärte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, die Menschen in einem 60 Kilometer entfernten Camp versorge. Von den Kindern unter fünf Jahren, die seit der Einnahme der Stadt durch die RSF am 27. Oktober angekommen waren, waren mehr als 70 Prozent akut mangelernährt, 35 Prozent von ihnen sogar schwer.

Lange können die Geflüchteten hier nicht bleiben.
© AFP | JORIS BOLOMEY
Sudan: Einen leichten Hoffnungsschimmer gibt es
Doch lange können die Geflüchteten nicht bleiben. „Die Leute werden aus Tiné umgesiedelt, um die Überbelegung zu verringern und Platz für neue Flüchtlinge zu schaffen“, sagt Ameni Rahmani von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Menschenrechtsorganisationen befürchten, dass die RSF-Kämpfer die ethnisch motivierte Gewalt in den von ihr besetzten Gebieten fortsetzen.
Überlebende hätten berichtet, dass es in der belagerten Stadt keine Möglichkeit gebe, an Nahrungsmittel zu gelangen. Menschen, die versucht hätten, Essen in die Stadt zu bringen, seien von den RSF getötet worden. „Wir fordern alle Konfliktparteien auf, humanitären Organisationen sicheren und ungehinderten Zugang zu gewähren, damit sie ihre Hilfe ausweiten und zur Bewältigung dieser Krise beitragen können“, betonte die Notfallkoordinatorin von Ärzte ohne Grenzen, Myriam Laaroussi.
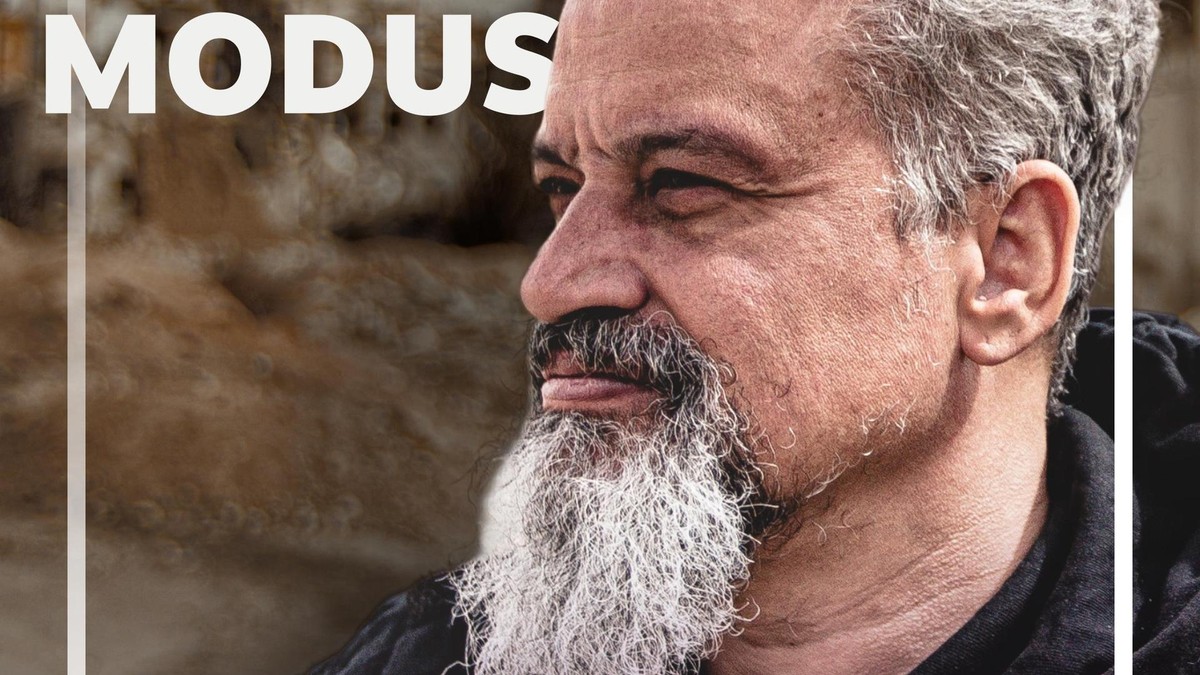
Eine politische Lösung des Konflikts sei bislang nicht in Sicht. Vereinzelt gebe es aber hoffnungsvolle Zeichen, erklärte Unicef-Gesandter Yett. „In einigen Regionen gehen Kinder zur Schule, Familien bauen ihr Leben wieder auf. Die Resilienz der sudanesischen Kolleginnen und Kollegen ist beeindruckend. Auch scheint die Welt endlich zu erkennen, dass der Sudan nicht im Stich gelassen werden darf.“















