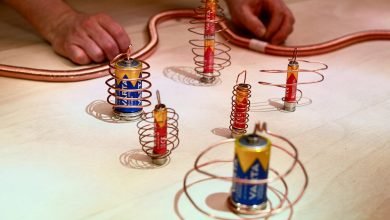Bill Gates, Indiana Jones und das Diskurs-Spektakel vor der Welklimagipfel in Brasilien | ABC-Z

Das Interesse am Klimawandel, so hieß es zuletzt ganz selbstverständlich, sei auf dem Nullpunkt. Politisch. Medial. Ökonomisch. Nicht nur der amerikanische Präsident, alle hätten sich abgewandt. Oder aufgegeben. Oder sich zu Tode gelangweilt von der Krisenlyrik. Und doch erleben wir in diesen Tagen vor dem UN-Klimagipfel COP30 im brasilianischen Belém das genaue Gegenteil: eine Sensibilität, vor allem aber eine kommunikative Mobilmachung, wie sie vor wenigen Klimakonferenzen bisher zu erleben war. Wie ist das zu erklären?
Vielleicht ja mit dem Multimilliardär Bill Gates. Vom Microsoft-Gründer, einer der schillerndsten Figuren im Fortschrittsdiskurs, bekannt durch seine prowissenschaftlichen Initiativen, gab es in den vergangenen Jahren immer mal wieder Wortbeiträge zur Frage, wie die Klimakatastrophe einzuhegen sei. Nun allerdings hat er sich in seinem Blog „Gates Notes“ aus der ersten Reihe im Kampf gegen die Krise abgesetzt. Was natürlich von Klimawandelskeptikern weidlich ausgeschlachtet wurde. In „drei Wahrheiten“ wandte er sich an die junge Generation, an Aktivisten, an Investoren und an die Politiker, die von kommender Woche an in Brasilien die klimapolitische Katastrophe zu verhindern versuchen. Im Kern sagt Gates: Alles halb so schlimm. Der Hunger und die Gesundheitskrisen der Welt hätten Priorität. Zudem vertraut er, was nicht überrascht, auf den technischen Fortschritt.
Was dieses ausführliche Memo von Gates auf den sozialen Plattformen und in Medien ausgelöst hat, lässt sich nur martialisch beschreiben. Es waren keine Wortgefechte, es war ein Klimakrieg um Worte. Dabei hat der reiche Technorentner nicht etwa den Klimawandel geleugnet. Genau so aber wurde diskutiert: Gates habe vorsätzlich den Eindruck vermittelt, es reiche ein „Pflaster für die Klimakrise“, klagte Klimaforscher Michael Mann. Gates zündele mit falschen Klimafakten.
„Einer der größten Kriminellen der Geschichte“
Etwa zur gleichen Zeit ergriff „Indiana Jones“ Harrison Ford im Field Museum in Chicago das Wort. Wegen US-Präsident Trumps heftiger Attacken auf die Klimapolitik mache er sich fast in die Hose. Sein Präsident sei, weil er die Fossilindustrie unterstütze, „einer der größten Kriminellen der Geschichte“. Und selbstverständlich fand auch diese pointierte Darbietung ein starkes Echo.
So geht das nun schon seit Tagen und absehbar weiter bis zum Ende des vielleicht traurigsten Klimagipfels aller Zeiten. Manchmal sind es Einzelstimmen wie diese, oder, was sich als Kommunikationstrend eingebürgert hat, in Unterschriftenlisten, Kollektiv-Stellungnahmen oder Manifesten. Jede dieser Wortmeldungen zeigt vor allem eines: dass das, was leichtfertig als „das Klimathema“ abgetan wird, den Menschen unter die Haut geht. 75 Unterschriften trägt ein von Ex-UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und Ex-Klimasekretariatschefin Christiana Figueres mit der Schauspielerin Dia Mirza vorgelegtes Papier, in dem Umwelttechnologien als die Krisenlösung beworben werden und die Unterzeichner sich der „großen Mehrheit“ der Weltbevölkerung zurechnen, „die wollen, dass schneller gehandelt wird“.
Es gleicht einem Dauerregen von Wahrheiten, Zahlen, Anklagen, Warnungen und Überzeugungen, die mal kreativer und mal überzeugender über die Leute ausgeschüttet werden. Juristisch könnte man sagen: Das Klimathema ist ein schwebendes Verfahren. Eines jedenfalls ist es nicht: Es ist nicht tot. Im „Klimafaktenpapier“, das auch soeben vom Deutschen Klima-Konsortium, dem Deutschen Wetterdienst und vier weiteren Organisatoren aufgelegt wurde, heißt es: „Eine repräsentative Umfrage unter rund 130.000 Personen in 125 Ländern zeigte, dass sich weltweit 89 Prozent der Menschen von ihren Regierungen eine ambitionierte Klimapolitik wünschen.“ Was will man gegen Fakten sagen?