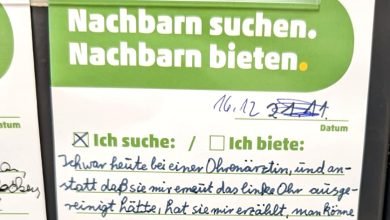Berliner Ufer: Zu nah am Wasser gebaut | ABC-Z

„Das Geld der Reichsten tummelt sich an wenigen Orten in Deutschland, und das ist auch hier am Wannsee“, sagt Christoph Trautvetter. Er ist Referent beim Netzwerk Steuergerechtigkeit und beschäftigt sich dort mit Superreichen und deren Eigentumsverhältnissen. Von rund 20 Billionen Euro Privatvermögen in Deutschland stecken 11,2 Billionen Euro in Immobilien, erklärt er. Insbesondere bei Luxusimmobilien sei über die tatsächlichen Besitzverhältnisse und Immobilienwerte aber wenig bekannt. Im Vorbeilaufen wirft Trautvetter deshalb immer wieder einen Blick auf Klingelschilder, um zu sehen, wer hier nun tatsächlich wohnt.
Schon immer zieht es Menschen an die Ufer. Sie sind ein Stück unbebaubare Weite, schaffen Überblick, sind Zugang zu Abkühlung und Wasserstraßen. Überall sind diese Grundstücke umkämpft. Während die Ufer immer mehr erschlossen werden, stellt sich jedoch die Frage, wer eigentlich einen Anspruch auf sie hat. Denn obwohl die meisten Seen öffentlich sind, sind es ihre Zugänge oft nicht.
Wem also gehören Berlins Ufer? Und wem sollen sie gehören? Der Frage der Uferprivatisierung am Wannsee hat sich der Bildungsverein Helle Panke der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit einem politischen Stadtspaziergang gewidmet. Neben Trautvetter sind auch die Linken-Politikerin Katalin Gennburg und Uferexperte Manfred Krauß vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) bei einem politischen Spaziergang am Donnerstagabend dabei. Sie führen rund zehn Leute entlang des Havelufers, erst am Wannsee im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, später in Kladow auf der westlichen Seite der Havel.
„Allen“, antwortet Katalin Gennburg, wenn man sie fragt, wem die Ufer gehören sollten. „Die Ufer sollten in ganz Berlin grundsätzlich frei zugänglich sein“, sagt sie, während sie in ihrer knallgrünen Jacke an den Einfahrten der Seegrundstücke entlangspaziert. Die gelernte Stadtbauhistorikerin sitzt seit 2025 im Bundestag und ist Sprecherin für Bauen und Stadtentwicklung. Zuvor saß Gennburg neun Jahre im Abgeordnetenhaus und kämpfte hier zwei Jahre lang für ein Uferwegekonzept für Berlin.
„Die Gegenwehr ist groß“
Im Jahr 2021 hat der rot-rot-grüne Berliner Senat beschlossen, dass Ufer und Gewässer der Allgemeinheit zugänglich sein müssen. Eine Uferwegekarte sollte erstellt, die Bezirke bei Uferwegekonzeptionen unterstützt werden. Vier Jahre später ist davon aber kaum etwas passiert. „Die Gegenwehr gegen freie Uferzugänge ist vonseiten der Immobilienbesitzer und Investoren in Berlin sehr, sehr groß“, weiß Gennburg.
Und das, obwohl „baurechtlich sehr viel möglich ist“, wie sie sagt. Neben dem großen politischen Besteck wie Enteignung oder Ankauf lasse sich bereits durch die Änderung von Flächennutzungsplänen, durch Bodenumlegungsverfahren und schlicht andere Bebauungspläne vieles verändern. „Es braucht aber den politischen Willen“, so Gennburg. Gerne zieht sie dabei das Beispiel Brandenburg heran, wo freie Ufer im Grundsatz für die Allgemeinheit gesichert wurden. „In Brandenburg steht auch die Uferfreiheit in der Landesverfassung, das braucht es auch für alle anderen Bundesländer!“, fordert sie.
Im heutigen Berliner Ortsteil Wannsee hat die Uferprivatisierung eine lange Geschichte: Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts schufen sich reiche Berliner hier ihren Erholungsort außerhalb der Stadt. Heute werden viele der Seegrundstücke zwar von Stiftungen genutzt – das Literarische Kolleg und die American Academy sind hier angesiedelt –, zugänglicher sind sie dadurch aber nicht geworden. „Durch den Grunewald im Norden und den Düppeler Forst im Süden mit freien Uferzugängen ist der Druck allerdings vergleichsweise gering geblieben“, sagt Manfred Krauß vom BUND. Krauß ist in Berlin als Biberexperte bekannt, aber auch sonst gut mit der Situation der Ufer vertraut.
„Mit einer Situation wie in Mitte oder Friedrichshain-Kreuzberg ist das hier nicht zu vergleichen“, meint Krauß. Dort sei der Flächendruck noch viel höher. Im Berliner Zentrum wird seit Jahrzehnten um die Ufer gestritten. Vor 17 Jahren stimmte bereits eine Mehrheit der Bürger:innen mit dem Bürgerentscheid „Spreeufer für alle“ für einen öffentlichen Uferweg. Heute ist davon im Stadtbild nichts zu sehen. Mit Ausnahme der Rummelsburger Bucht und einem kurzen Abschnitt an der East Side Gallery bleibt die Spree für die Öffentlichkeit weitgehend unerreichbar.
Stattdessen wird die Ufergegend im Rahmen des umstrittenen „Mediaspree“-Projekts zwischen Kreuzberg, Friedrichshain und Mitte mit Luxuswohnungen, Hotels und Bürogebäuden bebaut. Die Friedrichshainer Seite rund um die Uber-Arena ist schon weitgehend von Investoren „entwickelt“ worden. Auf der Kreuzberger Seite wurden in den letzten Jahren immer wieder Ufergrundstücke an private Investoren verkauft, die Bebauungspläne lassen hingegen noch auf sich warten.
Zurück zum Wannsee: Die kleine Gruppe sitzt mittlerweile auf der BVG-Fähre nach Kladow, vom Wannsee fährt man über die Havel an das westliche Ufer. Es geht vorbei an der Villeninsel Schwanenwerder, auf der einst NS-Funktionär Joseph Goebbels lebte und zuletzt eine 79 Millionen Euro teure weiße Villa die Gemüter erregte, die gegen geltendes Baurecht verstößt. Insbesondere die unbewohnten kleinen Inseln seien Rückzugsorte für Tiere, erklärt Krauß, hier lebten Biber, Fische, Kormorane und Graureiher.
Proaktive Ufergestaltung
In der Dämmerung gehen die Uferinteressierten an Land. Hier, in dem zum Bezirk Spandau gehörende Ortsteil Kladow, ist die Situation der Ufer hier eine ganz andere. Heute gibt es hier viele zugängliche Uferflächen und einen Uferradweg, der Bezirk beteiligt sich seit Jahrzehnten proaktiv an der Ufergestaltung. Das liegt teilweise daran, dass das westliche Havelufer lange landwirtschaftlich geprägt war und erst viel später von den Städtern entdeckt wurde. „Es liegt aber auch an klugen politischen Entscheidungen“, sagt Manfred Krauß.
Nachdem der damalige West-Berliner Bausenator Harry Ristock (SPD) bereits 1978 eine Uferkonzeption erarbeitet hatte, wurde die in Spandau auch tatsächlich umgesetzt. Das sei vor allem der Leiterin des Spandauer Grünflächenamts zu verdanken, erzählt der Uferexperte. Der Bezirk kaufte immer wieder freigewordene Uferflächen an und sicherte sie für die Öffentlichkeit. „Wie mutig ist die Politik und wie sind die Eigentumsverhältnisse – das sind die zwei wichtigen Fragen“, sagt Krauß.
Aber sind frei zugängliche Ufer aus Perspektive des Naturschutzes nicht auch kontraproduktiv? Das sei eine Abwägungsfrage, findet Krauß. „Solange es für den Naturschutz genügend Freiflächen gibt, ist der freie Zugang der Menschen an die Ufer auch ein hohes Gut.“ Immer wieder kommt es dabei aber auch zu Konflikten, wie in der Kladower Laubenkolonie Breitenhorn, an der die Gruppe nun vorbeiläuft. Wegen Überschwemmungsgefahr sollen die Lauben abgerissen, die Fläche renaturiert werden. Erst vor zwei Wochen protestierten rund 1.000 Kleingärtner dagegen mit einer Menschenkette.
Es ist dunkel geworden. Die inzwischen schon kleiner gewordene Gruppe Stadtspazierender hat sich entlang des Uferwegs versammelt, hin und wieder schlängeln sich einzelne Fahrradfahrer vorbei, es ist Zeit sich auf den Rückweg zu machen. Zum Abschluss will Krauß noch eine historische Perspektive beisteuern: Er deutet auf das mittlerweile schwer erkennbare gegenüberliegende Ufer, irgendwo dort liegt der Grunewald. Dass der in der heutigen Form erhalten ist, ist dem sogenannten Dauerwaldvertrag zu verdanken, durch den die Waldflächen bis heute geschützt und als Erholungsort für die Allgemeinheit gesichert wurden. „Auch das ist einem Zusammenschluss engagierter Bürger:innen zu verdanken“, sagt Krauß. Sein Gesichtsausdruck lässt sich in der Dunkelheit nicht mehr erkennen, aber er klingt hoffnungsvoll.