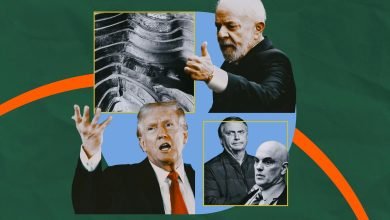Bayerische Königsschlösser sind Unesco-Weltkulturerbe | ABC-Z

Die ersten Überlegungen reichen dreißig Jahre zurück, seit zehn Jahren stehen die drei bayerischen Königsschlösser Neuschwanstein, Herrenchiemsee, Linderhof sowie das Königshaus am Schachen auf der deutschen Vorschlagsliste zum Unesco-Weltkulturerbe. Nun sind sie aufgenommen worden. In die Freude über eine für viele Beobachter längst fällige Entscheidung mischt sich auch das eine oder andere Schulterzucken.
Denn gefühlt waren und sind die Schlösser längst Weltkulturerbe, auch ohne offizielle Plakette. Wie kein anderer Bau repräsentiert Schloss Neuschwanstein als weltweit bekannte Ikone das Leben des verrückten Märchenkönigs, ist ein unwiderstehlicher Anziehungspunkt für Prinzessinnen- und Prinzenträumer, die einmal durch das Schlafzimmer eines Monarchen wollen, der nicht nur ein extrem fantasiebegabter Kunstliebhaber war. Er scheute sich auch nicht, mit seinen Bauten die Staatskasse in den Ruin zu treiben.
Für Vertreter der reinen Lehre standen Ludwigs Bauten immer unter Kitschverdacht: einfach so auf der größten Insel des Chiemsees Versailles nachzubauen, mit Linderhof eine Rokoko-Orgie ins Graswangtal zu stellen, eine Kunstritterburg mit Minaretten oberhalb der väterlichen Burg in die Ammergauer Alpen zu setzen. Die Zeit ist offenkundig über diese naserümpfende Haltung hinweggegangen, heute herrscht auch unter Fachleuten die Meinung vor, es handele sich um Gesamtkunstwerke, in denen Mittelalter und Barock, die Opern Richard Wagners und die Faszination für den Orientalismus zu einem spezifisch spätwittelsbachischen Amalgam verschmolzen sind.
Nicht nur Baustile unterliegen Moden, sondern auch deren Bewertung. Christoph Brumann vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung gab im Bayerischen Rundfunk zu Protokoll, der Historismus des späten 19. Jahrhunderts mit seinen Mittelalter-Träumen und -Fantasien werde mittlerweile „sehr viel milder beurteilt“ – in der Denkmalpflege allgemein, und bei der Unesco im Besonderen.

Die Aufnahme in die Welterbe-Liste ist ein Sieg für die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, eine Tochter des Finanzministeriums. Von dort kam die Lesart, Ludwigs Schlösser seien „gebaute Träume“ und „Sehnsuchtsorte“, die doch nur wiederkäute, worüber ein Millionenheer von Touristen mit den Füßen abstimmt. Der Zustrom begann 1886, wenige Wochen nachdem Ludwig II. unter bis heute ungeklärten Umständen im Starnberger See ertrunken war. Zwei Millionen Besucher pro Jahr kommen aktuell – danke, Eure Majestät, der Freistaat Bayern freut sich über diesen Geldregen, auch im Namen seiner Hoteliers, Wirtsleute, Busunternehmer etc. Freilich muss Bayern für den Erhalt auch einiges ausgeben, in den letzten drei Jahrzehnten flossen 43 Millionen Euro in die Renovierung von Neuschwanstein, und die neun Jahre währende Wiederherstellung der Venusgrotte in Schloss Linderhof kostete den Steuerzahler die Kleinigkeit von 58,9 Millionen Euro.
Die Unesco hat nun also den „außergewöhnlichen universellen Wert“ der Anlagen attestiert, womit sie die Intention ihres Erbauers konterkariert. Denn der Märchenkönig, der nur vierzig Jahre alt wurde, hatte nicht im Sinn, den Plebs jemals in die Nähe seiner Schlösser, geschweige denn in sein Schlafzimmer zu lassen. Im Gegenteil: Zerstört werden sollten die Schlösser nach seinem Tod, gesprengt.

Ihm ging es bis zuletzt und immer radikaler um die Selbstfeier seines Ingeniums. Als Eklektiker sagte er sich vom Ahnenkult seiner Vorfahren los, inszenierte stattdessen seine Privatmythologie mit Versatzstücken aus allen Stilen und Epochen. Um sein privates Illusionstheater perfekt zu gestalten, ließ er modernste Technik einbauen – Elektrizität, Telefon, Toilettenspülung und batteriebetriebene Lampen. Seine Bewunderer sehen in seiner Selbstinzenierung ein role model für die Popkultur, und tatsächlich war nicht nur Walt Disney von Ludwig II. so fasziniert, dass er sich für sein Firmen-Logo von Neuschwanstein inspirieren ließ. Auch Michael Jackson scheint ein Seelenverwandter des Märchenkönigs gewesen zu sein.

Üblicherweise ist einer der Effekte des Weltkulturerbe-Labels ein wachsender Zustrom von Touristen. Die Unesco fordert deswegen eine Strategie für die Besucherlenkung, aber die ist im Fall der Königsschlösser längst perfekt. Besonders im Fall Neuschwansteins scheint eine Optimierung schwierig: Mehr als die aktuell in den Sommermonaten kommenden gut 1,5 Millionen Besucher verkraftet das Schloss nicht. Mit rund 120 halbstündigen Führungen werden an Spitzentagen bis zu 8000 Besucher in einer exakt getakteten Logistik treppauf, treppab durch Gänge, Zimmer und Säle getrieben. Bliebe wohl nur, die Durchlaufzeit pro Führung noch weiter zu kürzen.
Ob sich die Gemeinde Schwangau, die 2023 via Bürgerentscheid für den Antrag stimmte, einen Gefallen getan hat, wird sich herausstellen. Die Bundesrepublik ist jedenfalls weiter auf der Unesco-Siegerstraße, sie liegt, dank ungebrochen fleißiger Bewerbungspolitik, im internationalen Vergleich auf Platz drei. Bayern hat jetzt elf Denkmäler auf der Liste, weil die Königsschlösser im Paket ausgezeichnet wurden. Entsprechend begeistert äußert sich Ministerpräsident Markus Söder: „Für unsere Märchenschlösser wird ein Märchen wahr“, heißt es von ihm in einer Mitteilung. Der Weltkulturerbestatus sei ein „Ritterschlag“, der Bayerns „Geschichte, Kultur und Baukunst“ würdige.