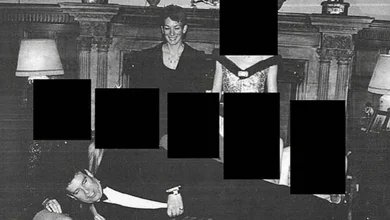Aus der Ukraine und Berlin: Diese Frau übernimmt das Jüdische Museum in München | ABC-Z

Das Jüdische Museum in München wurde 2007 eröffnet, Gründungsdirektor war Bernhard Purin, der am 18. Februar 2024 unerwartet starb. Aus dem Auswahlverfahren mit Stadtrats-Beteiligung zu seiner Nachfolge ging die Kulturwissenschaftlerin Alina Gromova hervor, die das Haus am Sankt-Jakobsplatz seit 1. September leitet.
Gromova ist 1980 im ukrainischen Dnipropetrowsk geboren und dort aufgewachsen. 1996 ging sie ins Internat nach Israel, 1997 kam sie mit ihrer Familie als Kontingentflüchtling nach Deutschland. Sie studierte Anglistik und Jüdische Studien und promovierte in Europäischer Ethnologie. Zuletzt arbeitete sie am Berliner Centrum Judaicum.
AZ: Frau Gromova, wie und wo knüpfen Sie da an?
ALINA GROMOVA: Ich kannte Herrn Purin nicht persönlich, aber seine Arbeit. Ich bin anders ausgebildet, anders sozialisiert, eine andere Generation. Was uns verbindet, sind Themen des Transnationalen und der Migration. Er hat immer auf das Verhältnis zwischen München und der Welt geschaut.
Was hat Sie gelockt, aus Berlin an die Isar zu kommen?
Mein Eindruck ist, dass Kultur hier überall ist. Es gibt in jedem Stadtteil ein Kulturzentrum. Mich interessiert, was es dort gibt. Wo sind die Münchner, die nicht zu uns kommen? In Berlin lag mein Fokus auf der Zusammenarbeit mit der Stadtgesellschaft. Auch hier im Haus ist die Vermittlungsarbeit zentral. Es gibt Guides, den man jederzeit ansprechen kann. Das ist etwas Besonderes. Das war Bernhard Purin wichtig und kommt mir entgegen.
„Yalla. Arabisch-jüdische Berührungen“
Gibt es noch ein unvollendetes Projekt von ihm, an dem Sie im Museum weiterarbeiten?
Es gibt einige begonnene Projekte. Es hinterlässt immer ein Trauma, wenn jemand so plötzlich aus dem Leben gerissen wird. Die Frage ist: Wie geht man mit dieser Lücke um? Schließt man sie schnell oder schaut man: „Was macht die Lücke mit uns?“
© IMAGO/Hanna Wagner
von IMAGO/Hanna Wagner
“}”>
Und wie gehen Sie damit um?
Im April eröffnet „Yalla. Arabisch-jüdische Berührungen“, eine Übernahme aus dem Jüdischen Museum Hohenems. Als ich hierhergekommen bin, war die Zeit knapp, etwas Eigenes zu erarbeiten. Darum habe ich nach einer Ausstellung gesucht, die gesellschaftlich relevant ist und an die aktuellen Entwicklungen anknüpft. „Yalla“ hat mich sehr angesprochen, weil es die Themen Migration und Mehrfach-Identitäten umfasst und entpolarisierend wirkt. Denn die Polarisierung ist das, was man seit dem 7. Oktober, dem Hamas-Überfall auf Israel und dem anschließenden Gaza-Krieg, beobachtet. Und ich wollte ein Projekt, das helfen kann, wieder das Gemeinsame zurückzuholen.
Auch Bernhard Purin hat eng mit Hohenems zusammengearbeitet.
Als ich dort ins Gespräch ging, wurde klar, dass er anfangs sogar an der Konzeption beteiligt war, die Schau sollte danach nach München gehen. Sie passt eben zu seiner Arbeit und zu meiner, so dass die Lücke überbrückt werden kann.

© Imago/Robert B. Fishman
von Imago/Robert B. Fishman
“}”>
Worum geht es genau?
Um Jüdinnen und Juden aus der arabischen Welt, aus muslimisch geprägten Ländern. Um das Zusammenleben und darum, warum sie diese später verließen, und wo die Migrationswege verliefen. Ein Fokus liegt auf Israel, auf den Mizrachim: Wie geht es den arabischen Jüdinnen und Juden dort? Sie wurden lange diskriminiert, durften nicht Arabisch sprechen, waren Menschen zweiter Klasse. In den späten 1960er Jahren startete eine Emanzipationswelle und wurde auch zur politischen Bewegung.
Wie stellen Sie das dar?
Die Schau zeigt das anhand von sieben Künstlerinnen und Künstlern aus Marokko, Ägypten, Libanon und Irak. Wir schauen auf Sprache, Literatur, Architektur, Musik und politische Identität. Es gab viele Zeiten friedlichen Zusammenlebens, es mischten sich Sprachen, Traditionen, Musik. Aber es gab auch Pogrome und Zerstörungen, von denen man in Europa wenig weiß, etwa die al-Farhud-Pogrome in Bagdad 1941. Generell möchte ich den Blick in die Vergangenheit als Geschichte der Aschkenasim erweitern. Mich marginalisierten Gruppen zuwenden, innerhalb der jüdischem Gemeinschaft und der Stadtgesellschaft. Hier leben viele Jüdinnen und Juden, die aus Irak oder Marokko, Aserbaidschan oder Türkei kommen.
Hybride Identitäten
Sie haben vorhin die Musik erwähnt. Spielt sie für Ihre Arbeit eine besondere Rolle?
Ich spreche gerne von einem resonanten Museum, das alle Sinne anspricht. Schauen und eine kognitive Herangehensweise sind in deutschen Museen noch sehr stark. Mit Exponaten so zu arbeiten, dass man sie sinnlich wahrnehmen kann, interessiert mich. Was löst ein Objekt, Klang, Geruch aus? Darum haben wir „Yalla“ für München mit Musik und Videos erweitert.
Was kommt danach?
Ich denke nicht nur in Ausstellungen. Es geht auch um Diskurse, darum, Themen zu setzen. Und ich will neue Publikumsgruppen erreichen. Darum mein Interesse an den Stadteilkulturzentren. Durch Verknüpfung soll Wissen entstehen, nicht nur vermittelt werden. 80 bis 90 Prozent der heutigen jüdischen Community in Deutschland kommt aus der ehemaligen Sowjetunion, sind aber in den etablierten Museen kaum sichtbar. Mein Interesse gilt hybriden Identitäten: Wir bezeichnen das als „Jüdisch plus“. Man ist ja nie nur jüdisch. Es geht auch um Themen wie Queerness. Da sind wir dabei, Formate entwickeln, in denen Raum für Erfahrungen und Geschichten der Teilnehmenden ist.

© Dana Flora Levy
von Dana Flora Levy
“}”>
Wie definieren Sie selbst Ihre Identität?
Meine eigene vielfache Identität prägt meine Arbeit. Sie hat meine Sensibilität für Ein- und Ausschlusserfahrungen geschärft. Ich kann mich nicht in Stücke teilen. Was man ist, ist davon abhängig, mit welchen Menschen man sich umgibt. Ich habe Familie in der Ukraine, in Israel, Freunde aus dem Iran.
Ein Museum für Brüche und Reibung
Was macht der Ukraine-Krieg mit Ihnen?
Wenn ich sehe, was der Krieg für jene bedeutet, die mir nahe sind, kann ich mir das auch bei allen anderen Betroffenen vorstellen.

© Matthias Schrader (dpa)
von Matthias Schrader (dpa)
“}”>
Was bedeutet der Krieg in Gaza für Ihre Arbeit?
Er hat uns auseinanderbracht. Die Emotionen sind sehr stark. Alle haben wahnsinnig viel Angst. Vor Ereignissen. Vor Menschen, die anders aussehen. Und Bedürfnis nach Schutz. Das Museum ist ein Raum für Begegnung und Gespräche. Für Brüche und Reibung. Für meine Arbeit wesentlich ist das Zuhören. Bevor man anfängt, Meinungen auszutauschen. Dann kann man besser aufeinander eingehen. Und auch gemeinsam etwas machen. Oder über die Exponate in Kontakt kommen.
Der Duft von Flieder gibt mir ein Gefühl von Heimat.
„Yalla“ geht mitten hinein in den Konflikt.
Ja, es geht um Menschen, die sich nicht einfach einer Seite zuordnen lassen. Um die Frage: Wie kann man in mehreren Lebenswelten gleichzeitig verortet sein. Es ist nicht unmöglich, sich jüdisch und arabisch zu fühlen, auch wenn man derzeit meint, dass das nicht zusammengeht. Aber Identität ist nie eindeutig, das ist eine Täuschung. Wir alle haben vielfältige Identitäten. Es gibt keine Homogenität. Und Migration ist keine Ausnahme, sondern die Regel.
Welchen Ort, Gegenstand, Klang oder Geruch verbinden Sie mit dem Gefühl von Heimat?
Das Haus in Dnjepropetrowsk, in dem wir 15 Jahre lang wohnten, war an einem zentralen Park gelegen, in dem viele Fliederbüsche standen. Ich habe als Kind Flieder gepflückt, gerochen, sogar gegessen. Der Duft von Flieder gibt mir ein Gefühl von Heimat.
Jüdisches Museum, Jakobsplatz, Dienstag – Sonntag: 10-18 Uhr, Eintritt: 6 / 3,60 Euro