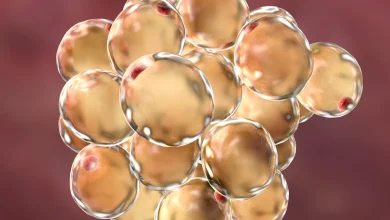Ärztekammern warnen: Deutschlands Gesundheitssystem ist nicht auf den Kriegsfall vorbereitet |ABC-Z

Schon von Weitem ist das typische Dröhnen eines Hubschraubers zu hören. Ein Black Hawk des amerikanischen Militärs fliegt einen kleinen Bogen und landet dann auf einer Wiese in der Nähe der deutsch-polnischen Grenze. Während sich die Rotorblätter weiterdrehen, hieven mehrere Soldaten einen Schwerverletzten auf einer Trage aus dem schwarzen Helikopter. Die amerikanischen Streitkräfte waren zufällig in der Nähe, als eine Marschkolonne der NATO angegriffen wurde.
Im Eiltempo bringen sie den Verletzten in das große grüne Zelt der Bundeswehr, das auf der Wiese aufgebaut wurde. Dort werden er und die anderen Verwundeten notfallmedizinisch erstversorgt, bevor sie weitertransportiert werden. Keine fünf Minuten später kehren die Soldaten mit der leeren Trage zum Helikopter zurück und steigen wieder ein. Kurz danach ist der Black Hawk schon wieder in der Luft und dreht ab.
„So oder so ähnlich könnte das ablaufen, wenn der Kriegsfall für Deutschland eintrifft“, sagt Sven Funke vom Sanitätsregiment 2 „Westerwald“ nach der Demonstration der Soldaten. Denn die Wiese liegt in Wirklichkeit nicht an der deutsch-polnischen Grenze, sondern am Schloss Oranienstein in Diez, einer Bundeswehrkaserne. Der Schwerverletzte ist ein Soldat mit Theaterschminke, und auch einen Angriff auf den NATO-Trupp hat es nicht gegeben. Doch es könne ihn vielleicht bald geben, sagt Siegfried Zeyer vom Heimatschutzregiment am Freitag beim Symposium Oranienstein 3.0 in Diez.
Risiko eines großen Angriffskriegs in Europa
„Lange war in Deutschland der Glaube weit verbreitet, dass Krieg kein Szenario ist, auf das wir uns vorbereiten müssen“, sagte kürzlich Ralph Tiesler, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe der „Süddeutschen Zeitung“. Das habe sich geändert. „Uns treibt das Risiko eines großen Angriffskriegs in Europa um.“ Unter diesem Motto diskutierten auf dem Symposium Ärzte, Apotheker, Reservisten und andere Angehörige der Bundeswehr über die ambulante medizinische Versorgung unter Verteidigungsbedingungen. Ausgerichtet wurde die Fachtagung von den Landesärztekammern Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie verschiedenen Gliederungen der Bundeswehr.
Im Ernstfall käme auf das deutsche Gesundheitssystem eine erhebliche Belastung zu, sind sich die Experten auf der Fachtagung einig. Oberstarzt Sebastian Hentsch schätzt, im Ernstfall pro Tag 1000 schwer verletzte Soldaten behandeln zu müssen, von denen zehn bis 30 Prozent eine intensivmedizinische Versorgung benötigten. Ihre Verletzungen seien immer in Kombination mit Verbrennungen, die eine lange Phase der Rehabilitation benötigten.
Dass die meisten außerdem eine ausgeprägte posttraumatische Belastungsstörung haben, „wird gern vergessen“, so Hentsch. Derzeit würden in Kliniken 1000 solcher Patienten im Jahr behandelt. Angesichts der Bettenkapazitäten in den deutschen Kliniken „bleiben bei mir durchaus Fragezeichen übrig“, sagt Hentsch. Im Ernstfall werde es eine Priorisierung bei der Versorgung der verwundeten Soldaten und Zivilisten geben müssen, sagt Hentsch. „Und die wird unangenehm werden.“
„Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen ist auch ein Problem für uns“, sagt Hentsch. Es gebe etwa nicht genügend Experten, die mit den komplexen Verletzungen umgehen könnten. Doch bevor er über die Auswirkungen davon im Krisenfall nachdenke, sollte dieses Problem erst einmal im Friedensfall gelöst werden, sagt Hentsch. Er setzt deshalb auf flächendeckende Weiterbildung. „Da sind wir zumindest auf einem guten Weg.“
„Unser System kann nicht Krise“
Damit das Gesundheitssystem im Ernstfall nicht kollabiere, brauche es neben genügend geeigneten Kliniken ein Trauma-Reha-Netzwerk. „Gerade bei neurologischen Problematiken kann man mit einer zeitigen Reha noch wirklich gute Ergebnisse rausholen“, so Hentsch. Außerdem fordert er einen Abbau der Bürokratie. Der strenge Datenschutz verhindere etwa die nötige Aufzeichnung des Gesamtlagebildes, wie viele Ärzte es in Deutschland gebe, die die Bundeswehr unterstützen könnten, sagt auch Stephan Hofmeister, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
Für den Krisenfall brauche es eine „strukturierte Zusammenarbeit zwischen Zivil und Militär“, so Hofmeister. Es müsse geklärt werden, wie im Krisenfall eine enge Koordinierung der verschiedenen Akteure des Gesundheitswesens und des Militärs stattfinden kann, sind sich die Experten auf dem Symposium einig. Außerdem brauche es mehr Rechtssicherheit für Ärzte und auch Apotheker außerhalb der Regelversorgung. Denn schon in Friedenszeiten fehlen in Deutschland immer wieder Medikamente. „Die große Abhängigkeit von Asien ist ein riesiges Problem“, sagt Uwe-Bernd Rose, Apotheker aus Königstein.
Derzeit sieht Hofmeister Deutschland nicht gut für eine Notlage aufgestellt. „Unser System kann nicht Krise“, sagt er. „Das hat zuletzt der mehr als 60 Stunden andauernde Stromausfall in Berlin gezeigt.“