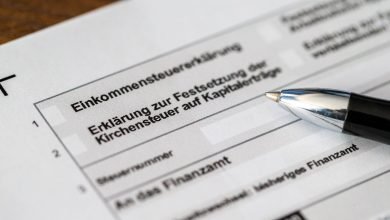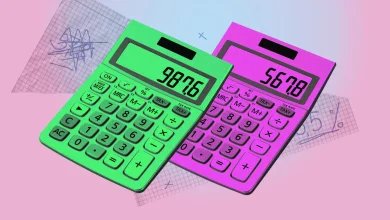„Art Basel and UBS Survey of Global Collecting“ | ABC-Z

Was wäre der Kunstmarkt ohne die Hochvermögenden? Auf Großmessen wie der Art Basel, deren Pariser Ausgabe gerade mit viel Aplomb für das VIP-Publikum geöffnet hat, sorgen sie für Millionenumsätze und den damit verbundenen Glamour. Zu wissen, in welche Richtung sich die Sammler, die durch die Gänge des Grand Palais drängen, im übergeordneten Sinne bewegen, ist für den Handel überlebenswichtig. Deshalb bleibt ihnen die Kulturökonomin Clare McAndrew mit ihrer Firma Arts Economics für die Art Basel und die Schweizer Großbank UBS auf den Fersen.
Alternative Anlageformen sind gefragt
Gleich eine der ersten Kennzahlen ihrer aktuellen Umfrage unter 3100 internationalen Kunstsammlern, welche jeweils mindestens eine Million Dollar flüssig haben, unterstreicht die Bedeutung der kulturaffinen Oberschicht für die Branche. Vermögende Sammler investieren demnach im laufenden Jahr 20 Prozent ihres Vermögens in Kunst – fünf Prozent mehr als im Vorjahr, wobei die Quote individuell mit wachsendem Kapital zur Hand und der eigenen Sammlererfahrung steigt.
Dazu passen die Erkenntnisse des im Juni veröffentlichten Vermögensreports der Beratungsfirma Capgemini. Er konstatiert von 2024 auf 2025 nicht nur einen Zuwachs von 6,2 Prozent bei der Anzahl sogenannter High Net Worth Individuals weltweit – mit dem größten Plus bei den hochvermögenden Ultra High Net Worth Individuals in den USA –, sondern auch eine gesteigerte Nachfrage dieser Klientel nach alternativen Anlageformen. Und dazu können neben Private Equity und Kryptowährungen auch Kunstwerke zählen.
Frauen vorneweg
Der von wirtschaftlichen Unsicherheiten und geopolitischen Krisen heftig angeschlagene Kunsthandel kann seine Hoffnungen vor allem auf eine Gruppe setzen: kaufkräftige Kunstsammlerinnen, die etwa die Hälfte der von Clare McAndrews Team befragten Personen stellen. Im Jahr 2024 lagen dem „Art Basel and UBS Survey of Global Collecting“ zufolge die Ausgaben dieser Frauen für Kunst und Antiquitäten um 46 Prozent über denen der Männer. Führend sind Sammlerinnen in China.
Anders, als man klischeehaft annehmen könnte, zeigen sich Sammlerinnen risikofreudiger als ihre männlichen Konterparts. Laut Umfrage stehen sie vielfältigen, auch neuen künstlerischen Medien offener gegenüber, während allgemein immer noch die Malerei dominiert. Sie interessieren sich eher für aufstrebende Künstler – und vor allem für Künstlerinnen. Das haben sie geschlechtsunabhängig mit jüngeren Käufern gemein.
Für Clare McAndrew ist klar, welche Folgen sich daraus ergeben. „Weil sich die Wohlstandsverteilung in den kommenden Jahren vertikal wie horizontal weiter verschieben wird, dürften diese Trends zu mehr Ausgewogenheit und Vielfalt beim Aufbau von Sammlungen führen“, sagt sie. Positive Nachrichten hat die Kulturökonomin für Kunstmessen. Der Anteil Vermögender, die dort ihre Kollektionen erweitern, sei leicht auf 58 Prozent gestiegen. Die postpandemisch verbreitete Unlust am Veranstaltungsbesuch in persona scheint also passé.
Mehr auf Messen, weniger im Auktionssaal
Wichtigste Vertriebskanäle für Kunst bleiben der Umfrage zufolge aber Galerien und Kunsthandlungen. Mehr als die Hälfte der Kundschaft shoppt inzwischen auch auf Instagram, und der Prozentsatz der Direktkäufe bei Kunstschaffenden hat sich verdoppelt. Entsprechend stehen Atelierbesuche hoch im Kurs. Sie befriedigen einen größer gewordenen Hunger auf Neues: 66 Prozent der Befragten gaben an, jüngst Arbeiten von Künstlern erworben zu haben, die sie erst kürzlich entdeckten. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 43 Prozent vor drei Jahren.
Und die jungen Sammler? Sie kaufen kreuz und quer Kunsthandwerk, Design, Schmuck, Handtaschen, Sneaker und andere Sammlerwaren. Bei Kunst zeigt die Generation Z ein Faible für Digitales, während Millennials Drucke, Fotografien und Arbeiten auf Papier bevorzugen – also klassische Einstiegsprodukte für Kunstkäufer. Überhaupt bleibt dann doch vieles, wie es ist. Fast alle von Art Economics befragten Gen-Z-Sammler, die Kunstwerke geerbt haben, wollen diese behalten. Über alle Generationen hinweg planen 80 Prozent der Sammler, ihre Kollektionen zu vererben.

Festhalten an dem, was man hat: Das ist eine gängige Strategie für unsichere Zeiten. In Auktionshäusern weiß man ein trauriges Lied davon zu singen. Die Versteigerer müssen nicht nur verstärkt um Einlieferungen werben, sondern auch um Kaufkundschaft, legt die Umfrage nahe. Nur mehr knapp die Hälfte der in ihr Auskunft gebenden Sammler, nämlich 49 Prozent, hat 2024 und 2025 eine Erwerbung auf einer Auktion getätigt. Das ist ein dramatischer Einbruch: 2023 waren es noch 74 Prozent. Dass Männer mehr Geld bei Versteigerungen lassen als Frauen, entspricht wiederum dem Stereotyp von kompetitiver Maskulinität.
Insgesamt verliert der Wettstreit an Bedeutung. Nur zwölf Prozent ihrer Ausgaben für Kunst haben die vermögenden Sammler der Erhebung zufolge im vorigen und laufenden Jahr auf Auktionen getätigt, etwa halb so viel wie 2023. Und nur 40 Prozent der Befragten wollen in den kommenden zwölf Monaten mehr Kunst kaufen als im Jahr zuvor – 2023 hatten das noch 54 Prozent vor.
Was heißt das alles? Dass der Kunstmarkt weiblicher und vielfältiger wird, aber auch intransparenter und von Unsicherheiten bestimmt. Dafür steht bei Auktionshäusern schon seit Längerem der Trend zu Privatverkäufen, in denen die Verkaufspreise diskret hinter den Kulissen verborgen bleiben.