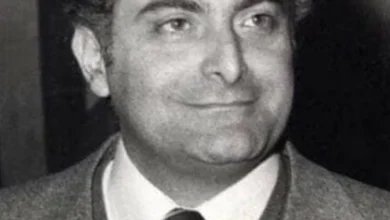Kryptodienst Anom: FBI-Operation beruht auf fragwürdigem Beschluss | ABC-Z

Das Bezirksgericht Vilnius ist in einem Palast im Zentrum der litauischen Hauptstadt untergebracht, hinter einer Fassade voll von Säulen und Simsen. Eine Richterin dort unterschreibt am 3. Oktober 2019 einen Beschluss, der die organisierte Kriminalität in Europa erschüttern wird. Die Richterin erlaubt es der litauischen Polizei, sich Zugang zu den Räumen eines Serverbetreibers zu verschaffen. Sie erlaubt es den Polizisten, „heimlich“ – und dieses Wörtchen könnte noch wichtig werden – die Daten eines bestimmten Servers zu kopieren, regelmäßig alle zwei bis drei Tage, um diese dann an die USA weiterzuleiten.
Auf dem Server liegen, so schreibt die Richterin, verschlüsselte Nachrichten eines Kryptodiensts „der nächsten Generation“. Er werde von internationalen kriminellen Organisationen genutzt, und zwar ausschließlich zum Drogenhandel und zur Geldwäsche. Das hätten die amerikanischen Behörden herausgefunden.
Was in dem Beschluss fehlt, ist der Name des Kryptodienstes: Anom. Was außerdem nicht drinsteht: Der Server wird nicht von Kriminellen betrieben. Nach Informationen der F.A.Z. hat ihn die litauische Polizei selbst angemietet. Im Auftrag des FBI, das den „Kryptodienst der nächsten Generation“ entwickelt und auf den Markt gebracht hat. Das Ganze ist eine Falle. Wahrscheinlich die größte, die Ermittler im Kampf gegen das organisierte Verbrechen je gestellt haben.
Mehr als 860 Strafverfahren allein in Deutschland
Tausende Kriminelle in aller Welt tappen hinein, Drogen- und Waffenhändler, Geldwäscher und Mörder. Allein die deutschen Strafverfolger haben auf Grundlage der Chatnachrichten, die auf dem Server in Litauen landeten, schon mehr als 860 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Noch immer werden vor deutschen Gerichten Dutzende Prozesse gegen Anom-Nutzer geführt.
Auch der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich mit Anom befasst. Ende vergangenen Jahres lehnten die Richter die Beschwerde von Anwälten ab, die argumentiert hatten, dass die entschlüsselten Chats nicht als Beweismittel genutzt werden dürften. Der Beschluss der Richterin in Vilnius lag dem BGH nicht vor. Sowohl von Litauen als auch von den USA wird er unter Verschluss gehalten wie ein Staatsgeheimnis.
Die deutschen Strafverfolgungsbehörden, die die Anom-Daten per Rechtshilfe von den Amerikanern bekommen haben, wissen nach eigenen Angaben bis heute nicht einmal, in welchem Land der Beschluss erlassen wurde. Doch auch wenn dieses Land unbekannt bleibe, urteilte der 1. Strafsenat des BGH, dürfe nicht davon ausgegangen werden, dass es sich rechtswidrig verhalten habe. Es gebe dafür keine belastbaren Anhaltspunkte.
Der F.A.Z. ist es nun gelungen, den Beschluss der litauischen Richterin zu bekommen. Auch der finnische Sender Yle und die litauische Nachrichtenseite 15min konnten ihn einsehen. Außerdem wurden den Medien Hunderte Seiten Akten zugespielt, darunter der E-Mail-Austausch zwischen FBI-Agenten und der litauischen Polizei. Diese Dokumente sind genau das, was der BGH nicht sah: belastbare Anhaltspunkte dafür, dass die Ermittler im Lauf der Operation nicht nur Kriminelle getäuscht haben, sondern auch das Gericht. Um den Beschluss zu bekommen, der für das Kopieren der Anom-Chats notwendig war, das legen die Recherchen nahe, verschwiegen Polizei und Staatsanwaltschaft der Richterin die wahren Hintergründe. Sie täuschten, mindestens implizit, einen anderen Sachverhalt vor. Und spätestens beim Wörtchen „heimlich“ logen sie. Schließlich wollten sie ja nur Daten von ihrem eigenen Server kopieren.
„Sollten diese Rechercheergebnisse zutreffen“, sagt Matthias Jahn, Professor für Strafrecht an der Goethe-Universität und Richter am Oberlandesgericht Frankfurt, „dann stürzt die ganze Argumentation des Bundesgerichtshofs in sich zusammen wie ein Kartenhaus – zum Schaden der Glaubwürdigkeit unseres Rechtsstaats.“
Gut 300 Angeklagte sind laut Bundeskriminalamt im Rahmen der FBI-Operation in Deutschland schon verurteilt worden. Professor Jahn, dem die geheimen Anom-Dokumente nicht vorliegen, dem die F.A.Z. aber Passagen daraus geschildert hat, hält es für denkbar, dass diese Strafverfahren nun wieder aufgenommen werden müssen, selbst wenn die Verurteilungen schon rechtskräftig sind. „Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass sich die deutsche Justiz hat hinters Licht führen lassen, dann muss das zumindest geprüft werden“, sagt er. „Für die deutsche Rechtsprechung in Strafsachen wäre das der größte anzunehmende Unfall.“
FBI-Agenten vermarkten Handys in der Unterwelt
Um zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, dass FBI-Agenten aus San Diego Kryptohandys in der Unterwelt vermarkteten, dass Chatnachrichten eines Kokainhändlers aus Bruchsal genauso auf dem Server in Litauen landeten wie die von albanischen Cannabiszüchtern und dass nun die Glaubwürdigkeit des deutschen Rechtsstaats an einem Beschluss des Bezirksgerichts Vilnius hängen soll, muss man ein paar Jahre zurückgehen. An den Anfang dieser unglaublichen Operation.
2018 war es FBI-Agenten gelungen, einen Kryptodienst namens Phantom Secure zu zerschlagen. Über den verschlüsselten Messenger hatten Rauschgifthändler ihre Geschäfte koordiniert. Hells Angels in Australien und das mexikanische Sinaloa-Kartell gehörten zu den Kunden. Das FBI nahm den kanadischen Chef von Phantom Secure fest. Außerdem gelang es den Agenten, einen der Zwischenhändler auf ihre Seite zu ziehen. Er war gerade dabei, ein eigenes Kryptohandy zu entwickeln: Anom. Das FBI bot ihm Strafnachlass an und durfte im Gegenzug bei Anom einsteigen – streng geheim natürlich.

Die ursprüngliche Idee der Agenten in San Diego war es, Anom in den USA auf den Markt zu bringen und heimische Drogenhändler in die Falle zu locken. So schildert es einer von ihnen der F.A.Z. Das Justizministerium in Washington aber setzte schließlich auf einen viel größeren Plan. Die Weltpolizei im Einsatz.
Um Kommunikation wie Chat- oder Sprachnachrichten abfangen zu dürfen, brauchen Polizisten die Erlaubnis eines Richters, schließlich handelt es sich um erhebliche Eingriffe in die Privatsphäre. In den USA sind die Gesetze dafür sehr streng. Bis zum Ende der Operation hatte das FBI keinen US-Gerichtsbeschluss vorliegen. Die Software des Kryptodienstes war so programmiert, dass Nachrichten von Nutzern, die sich auf amerikanischem Boden befanden, automatisiert aussortiert und nicht abgefangen wurden; so jedenfalls erklärte es das FBI später.
Die Vermarktung der Anom-Handys begann in Australien, wo der übergelaufene Entwickler gute Kontakte ins kriminelle Milieu hatte. Wie in der Branche üblich lief der Vertrieb über persönliche Kontakte und Empfehlungen, der Slogan: „Von Kriminellen für Kriminelle“. Die australische Polizei erwirkte einen Beschluss, alle Nutzer in ihrem Land überwachen zu dürfen. Eine Weitergabe der Daten an andere Länder erlaubte das australische Gericht nicht.
Rund 400 Seiten interne E-Mails
Anfang 2019 machte sich das FBI auf die Suche nach einem dritten Land, das sich an der Geheimoperation beteiligen würde. Wie sie dabei ausgerechnet auf Litauen kamen, ist unklar. Womöglich lag es an den guten Erfahrungen, die US-Sicherheitsbehörden dort gemacht hatten. Nach dem 11. September 2001 hatte die Regierung in Vilnius der CIA erlaubt, auf litauischem Boden Foltergefängnisse für Terrorverdächtige einzurichten.
Im Frühjahr 2019 jedenfalls reisen Polizisten aus Litauen zu Europol in Den Haag. Das FBI stellt dort seine Operation vor. Und wenig später schreiben die Litauer in einer E-Mail: „Wir möchten unsere feste Absicht bekräftigen, dieses Projekt nach besten Kräften zu unterstützen.“
Rund 400 Seiten ist der E-Mail-Austausch lang, den die F.A.Z. zugespielt bekommen hat. Anhand von Gerichtsdokumenten aus den USA, die öffentlich zugänglich sind, lässt sich nachvollziehen, dass genau diese Kommunikation in den entsprechenden Prozessen dort eine Rolle spielte – und dass das Gericht sie als besonders geheim eingestuft hat. Außerdem konnten die F.A.Z. und ihre Recherchepartner die zugespielten Unterlagen mit Gerichtsakten aus mehreren Ländern sowie mit öffentlichen und nicht öffentlichen Informationen über die Operation abgleichen. Zeitabläufe, Daten, Namen und viele andere Fakten ließen sich so überprüfen. Es ergaben sich keine Hinweise, dass die Unterlagen nicht authentisch sein könnten.

Im Sommer 2019 geht es in den E-Mails vor allem um eine Frage: Wie sollen die amerikanischen Behörden ihr Rechtshilfeersuchen an Litauen formulieren, um – wie es ein litauischer Polizist schreibt – „rechtliche Probleme mit unseren Gerichten zu vermeiden“?
Die amerikanischen Agenten schicken Entwürfe und zusätzliche Informationen. „Mehr als genug“, kommentiert der litauische Liaison-Beamte bei Europol in einer Mail und fügt in Klammern hinzu: „wahrscheinlich zu viel ;)“. Die Amerikaner fragen nach, ob sie in dem Rechtshilfeersuchen erwähnen sollen, dass ein Server in Litauen aufgestellt werden „kann/wird“.
Die litauischen Polizisten sprechen sich mit ihrer Generalstaatsanwaltschaft ab und streichen in einem der Entwürfe die Formulierung, dass das FBI den Kryptodienst entwickelt und erfolgreich an wichtige Kriminelle verteilt habe. Sie bitten laut den Dokumenten darum, nicht zu schreiben, dass auf dem Server „entschlüsselte“ Nachrichten gespeichert seien, sondern „verschlüsselte“. Und sie betonen, dass es wichtig sei, dass in dem Rechtshilfeersuchen nicht stehe, dass sie den Server überwachen, sondern dass sie Kopien davon machen sollen. Und zwar „heimlich“.
Ende August 2019 findet laut den E-Mails eine Besprechung statt, in der es um die technischen Anforderungen an den Server geht. Als das geklärt ist, schickt das FBI eine formelle Anfrage und bittet die litauische Polizei darum, einen Server zu kaufen oder zu mieten, auf dem Kopien von Nachrichten gespeichert werden können, die über einen Kryptodienst laufen, der vom FBI entwickelt wurde. Die Anfrage erreicht Litauen auf dem Weg der polizeilichen Zusammenarbeit. Für die litauische Justiz sind die Informationen darin offensichtlich nicht bestimmt.
Plötzlich klingt es, als sei der Server vom Himmel gefallen
Als das US-Justizministerium Ende September sein offizielles Rechtshilfeersuchen an Litauen schickt, klingt es darin ein bisschen, als sei der Server vom Himmel gefallen. Verdeckte Ermittlungen hätten ergeben, schreiben die Amerikaner, dass Mitglieder „bekannter transnationaler krimineller Organisationen“ nun „kryptierte Kommunikationsgeräte der nächsten Generation“ nutzten. Der Server, der die verschlüsselten Nachrichten enthalte, stehe in Litauen – und zwar „by design“, heißt es, also „absichtlich“ oder „von Haus aus“. Wer den Server betreibt, wie die verschlüsselten Nachrichten dort landen und wer hinter all dem stecken soll, wird mit keinem Wort erwähnt.
Am 3. Oktober 2019 stellt die litauische Generalstaatsanwaltschaft unter Berufung auf das Rechtshilfeersuchen einen entsprechenden Antrag. Und noch am selben Tag unterzeichnet die Richterin am Bezirksgericht ihren Beschluss.

Ob die Richterin die wahren Hintergründe der Operation kannte, in ihrem Beschluss aber nicht erwähnte, lässt sich auf Grundlage der Dokumente nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Wahrscheinlich ist es nicht – in Anbetracht des monatelangen E-Mail-Austauschs, von Telefonkonferenzen und Besprechungen, die die litauische Polizei und Staatsanwaltschaft mit dem FBI darauf verwendeten, das Rechtshilfeersuchen auszuarbeiten. Das Gericht in Vilnius reagierte auf eine entsprechende Anfrage nicht.
Remigijus Merkevičius hat auch eine Vermutung, warum die Richterin getäuscht worden sein könnte. Er ist Anwalt und Dozent für Strafrecht an der Universität Vilnius. Mit den Prozessen rund um Anom, die auch in Litauen geführt werden, hat er nichts zu tun. Nachdem ihm die F.A.Z. ihre Recherche geschildert hat, sagt er: Hätte die Richterin gewusst, dass das FBI die Kryptohandys selbst auf den Markt gebracht hatte, hätte sie gewusst, dass die litauische Polizei den Server angemietet hatte, dann hätte sie erst einmal prüfen müssen, ob das nicht verbotene Tatprovokationen gewesen wären und ob sich die Ermittler damit nicht der Beihilfe etwa zum Drogenhandel strafbar gemacht hätten. Den Beschluss, sagt er, hätte die Richterin wohl nicht unterschrieben.
Kein Kommentar
Das FBI will das Thema auf Anfrage nicht kommentieren. Europol betont, dass man an der Operation nur unterstützend mitgewirkt habe. Die litauische Polizei verweist bei dem Thema auf die Generalstaatsanwaltschaft – die in ihrer Antwort nicht auf den detaillierten Fragenkatalog der F.A.Z. eingeht. Wegen laufender Gerichts- und Ermittlungsverfahren könne man sich nicht äußern, schreibt eine Sprecherin. Außerdem kommentiere man nicht die „subjektive Interpretation“ von Daten und Beweisen aus Strafsachen. Ohne das irgendwie zu belegen, unterstellt sie der F.A.Z. und ihren Recherchepartnern, sich von Beschuldigten und deren Verteidigern einspannen zu lassen. Die Operation rund um Anom, betont sie, sei ein hervorragendes Beispiel für die erfolgreiche und enge internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen die gefährlichsten Gruppierungen der organisierten Kriminalität.
Wie gut die Falle des FBI funktioniert, auch das lässt sich in den E-Mails nachlesen, die der F.A.Z. vorliegen. Die Anom-Handys stoßen bei internationalen Drogenhändlern auf große Nachfrage. Nach drei Monaten schicken die Amerikaner eine erste Bilanz: Fast 300.000 Nachrichten von fast 500 Geräten in 37 Ländern seien schon ausgewertet worden. Bald wird der Server, den die litauische Polizei in der Stadt Šiauliai angemietet hat, zu klein. Mehrmals müssen sie Speicherplatz hinzufügen. Die US-Behörden schicken weitere Rechtshilfeersuchen, damit die litauischen Polizisten den Server weiter überwachen können. Viermal verlängert das Gericht in Vilnius die Maßnahmen.

Als am 7. Juni 2021 der letzte Gerichtsbeschluss ausläuft, schlagen Polizisten rund um den Globus zu. Mehr als 12.000 Anom-Handys sind laut FBI zu diesem Zeitpunkt im Umlauf. Mehr als 27 Millionen Nachrichten aus mehr als 100 Ländern wurden abgefangen. In vielen Ländern dauert die Auswertung bis heute an.
Trotz dieser Erfolge im Kampf gegen das organisierte Verbrechen kritisiert Professor Jahn das Vorgehen der Ermittler, wie es die F.A.Z. rekonstruiert hat: „Wenn die Dokumente authentisch sind, kann man einen bewussten Rechtsverstoß kaum besser dokumentieren“, sagt er. „Und wenn in einem Strafverfahren entscheidende Tatsachen einem Richter gegenüber bewusst unterdrückt werden, widerspricht das EU-Recht, ganz ohne Zweifel.“
Als die Richter des Bundesgerichtshofs ihr Urteil zu den Anom-Chats schrieben, vermerkten sie auf dem Deckblatt nicht nur, dass es zur Veröffentlichung bestimmt sei, sondern auch, dass es in die Sammlung der wichtigsten BGH-Entscheidungen aufgenommen werden soll. Für so grundlegend hielten sie ihr Urteil. Die Richter beriefen sich auf den „Grundsatz gegenseitigen Vertrauens“: Dieser gebiete, dass die deutsche Justiz den Auskünften der amerikanischen Behörden glaube – auch wenn sich diese im Fall von Anom weigerten, den richterlichen Beschluss vorzulegen, auch wenn sie sich weigerten, nur das Land zu nennen, in dem er ergangen war.
Professor Jahn kritisiert das als allzu blauäugig. Wenn die Rechercheergebnisse jetzt zeigten, dass in Litauen rechtsstaatliche Mindeststandards nicht eingehalten worden seien, sagt er, dann breche die gesamte Argumentation des BGH in sich zusammen. Und das wiederum habe enorme Auswirkungen auch über den Fall Anom hinaus. Das gegenseitige Vertrauen, auf dem in der internationalen Zusammenarbeit der Strafverfolgungs- und Justizbehörden so vieles aufbaue, werde in den Grundfesten erschüttert.
Jahn fordert, dass der Fall nun auch auf EU-Ebene aufgearbeitet wird. Der Zweck heilige, auch wenn es um schwere Straftaten im Bereich organisierter Kriminalität gehe, nicht jedes Mittel. Zumal die Grundsätze der Rechtshilfe in allen Bereichen des Strafrechts gelten würden, auch bei Fragen der Meinungsäußerung. Er warnt: Wenn die USA in ihrer derzeitigen politischen Situation und ein willfähriger EU-Staat zusammenkämen, könne es schnell auch um Bereiche gehen, die fast jeden deutschen Bürger betreffen könnten.