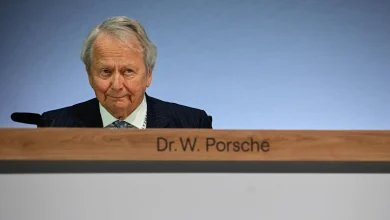Allensbach-Studie: Für Deutsche ist die Autoindustrie die wichtigste Branche | ABC-Z

Vor einem Verlust großer Teile der Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie warnt die Präsidentin des Branchenverbandes VDA, Hildegard Müller: „In der aktuellen Lage wird täglich gegen den Standort Deutschland und Europa entschieden“, sagt Müller in einem Gespräch mit der F.A.Z. „Von deutschen Autokonzernen und Zulieferern werden auch in Zukunft Autos produziert, aber die Frage lautet, wie viele davon in Zukunft noch in Deutschland gebaut werden können“, mahnt die Präsidentin des Verbandes der deutschen Automobilindustrie. Der Wirtschaftsstandort Deutschland werde belastet von Energiekosten, die drei bis fünf Mal so hoch seien wie in den USA oder China; bei der Steuerlast liege Deutschland am oberen Ende der OECD-Statistik. „Dazu kommt noch riesige Bürokratie, die immer weiter wächst – besonders von Brüssel aus.“
„Wenn aber erst einmal im Ausland eine neue Fabrik gebaut ist, dann sind die Arbeitsplätze auf lange Zeit weg“, warnt Müller. Auch die deutsche Autoindustrie investiere ihr Geld zunehmend außerhalb Deutschlands, weil anderswo die Standortbedingungen besser seien. Dabei gehe es um große Beträge, innerhalb von nur vier Jahren weltweit rund 320 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung, weitere 220 Milliarden Euro unter anderem für die Erneuerung von Fabriken, aber auch für neue Produktionsstandorte.
„Zur Entstehung neuer Arbeitsplätze muss sich erst etwas bewegen“
Verwundert zeigt sich Müller darüber, dass zuletzt nur wenige Stimmen in der Öffentlichkeit damit gerechnet hätten, dass nun die immer wieder mahnend beschriebenen Schwierigkeiten für die Autoindustrie auch eintreten: „Jüngst wurde berichtet, dass innerhalb eines Jahres 50.000 Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie verloren gegangen sind, und vielerorten war die Überraschung groß. So was wundert mich dann, denn wir haben schon lange darauf hingewiesen, dass die Wertschöpfung bei Elektroautos geringer ist. Das gehört zur Wahrheit einfach dazu – auch wenn die Politik das ungern sagt.“
Die deutsche Autoindustrie teile die Auffassung, dass eine Transformation der Antriebstechnik notwendig sei, sagt Müller, doch Standortfaktoren und Antriebwende wirkten erst einmal negativ auf die Beschäftigung. „Umso wichtiger ist, dass neue Arbeitsplätze hierzulande entstehen können, aber dazu muss sich etwas bewegen.“
Sollten Deutschland und die EU denn versuchen, mit Investitionszuschüssen die Entstehung deutscher und europäischer Zulieferer etwa für Batteriezellen zu begünstigen? Müller hat darauf eine harte Antwort: „Es ist nicht genug, wenn man eine Subvention für ein neues Werk bezahlt, ohne die anderen Standortfaktoren zu verbessern. Subventionen sind selten der richtige Weg, und sie helfen nicht, wo grundlegende Reformen verweigert werden“, meint sie. Wer mangelhafte Wirtschaftspolitik betreibe, habe dann irgendwann ohnehin kein Geld mehr, um seine Reparaturpolitik zu finanzieren. „Deutschland und Europa betreiben seit Jahren immer mehr Reparaturpolitik an Symptomen, bekämpfen aber nicht die Ursachen mangelnder Wettbewerbsfähigkeit. Manchmal fragt man sich dann: Hast du ein déjà-vu?“
Für die Deutschen ist die Autoindustrie die wichtigste Branche
Wie wichtig den Deutschen die Autoindustrie ist, zeigt eine vom VDA beim Institut für Demoskopie Allensbach in Auftrag gegebene Studie, deren Ergebnisse der F.A.Z. vorliegen: Zur Frage „Welche Branchen sind für Deutschland besonders wichtig?“ stimmten (bei Mehrfachnennungen) 87 Prozent für die Autoindustrie, 71 Prozent für das Handwerk, 70 Prozent für die Maschinenbaubranche, 66 Prozent für die Metallindustrie. Bauwirtschaft (64 Prozent), Chemie (61 Prozent) und Pharmaindustrie (57 Prozent) teilen sich die folgenden Plätze. Der Zuspruch für die Autoindustrie war dabei überdurchschnittlich hoch in der Altersgruppe von 45 bis 59 Jahren (92 Prozent), gefolgt von den 30- bis 44-Jährigen (90 Prozent) und den Befragten im Alter zwischen 16 und 29 Jahren (88 Prozent).
„Die Menschen in Deutschland sind stolz auf die Autoindustrie, als Arbeitgeber und als Motor der Wirtschaft“, kommentiert VDA-Präsidentin Müller. „Die große Mehrheit findet Autos gut. Das in der öffentlichen Diskussion oft wiederholte Bild einer allgemeinen Ablehnung von Autos hat daher wenig mit den Fakten zu tun.“ Dementsprechend könnte ein Verlust von Teilen der deutschen Autoindustrie auch dramatische Folgen haben: „Deutschland ist stabil, weil es stabil in den Regionen ist, sich die Wertschöpfung und Arbeitsplätze über die Regionen verteilen“, sagt Müller. „Doch wenn wir nun gerade unter den Autozulieferern viele Standorte in den Regionen verlieren, kommt das Land aus der Balance. Der Verlust von Beschäftigung und Wohlstand, zieht nicht nur wirtschaftliche Konsequenzen nach sich, sondern auch gesellschaftliche.“
Solche Mahnungen werden in der öffentlichen Diskussion immer wieder mit dem Kommentar verbunden, dass die deutsche Autoindustrie wohl mit solchen Mahnungen die glorreichen Zeiten des Verbrennerzeitalters beschwören wolle und nicht genügend für die technische Transformation getan habe.
Doch die VDA-Präsidentin hat dazu eine nachdrückliche Entgegnung: „Denjenigen, die immer noch behaupten, die deutsche Autoindustrie habe die Elektromobilität verschlafen, können wir mit Fakten begegnen: Deutschland ist weltweit der zweitgrößte Produktionsstandort für Elektroautos.“ Die inländische Produktion von elektrisch angetriebenen Pkw – sowohl batterieelektrisch als auch Plug-in-Hybride – in Deutschland werde 2025 deutlich steigen, voraussichtlich auf 1,7 Millionen. „Das Angebot wächst ständig: Allein auf dem deutschen Markt bieten die deutschen Hersteller rund 110 verschiedene E-Modelle an, weltweit sind es sogar etwa 160.“
Aus diesen Informationen bezieht Müller wiederum die Legitimation für harte Kritik an der Klimapolitik der EU-Kommission: „Es geht nicht, dass Brüssel, losgelöst von der Realität der Transformation, einfach irgendwelche Ziele in die Gesetze schreibt und sich dann nicht um die Rahmenbedingungen kümmert, die für das Erreichen dieser Ziele nötig sind. Das ist schlicht keine Politik.“ Deswegen sei nun in Europa „eine deutlich hörbare deutsche Stimme“ nötig. Das sei während der vergangenen Jahre nicht der Fall gewesen, ändere sich aber jetzt langsam. Die deutsche Stimme müsse nun hörbar sein, wenn über den Green Deal und die Klimaziele für die Autoindustrie geredet werde und über die Frage, ob und wie diese Ziele erreichbar seien. „Da müssen alle ehrlich sein in der Analyse der aktuellen Lage“, verlangt die VDA-Präsidentin.
Die Autoindustrie will eine Revision für CO2-Ziele und Verbrenner-Aus
Müller strebt nach deutlichen Änderungen an den bisher vorgegebenen CO2-Zielen und nach einer Revision für das bisher beschlossene Verbrenner-Ende im Jahr 2035: „Wir sind für das Erreichen der europäischen Klimaziele, aber unter den gegenwärtigen Umständen, mit Zweifeln der Bevölkerung am E-Auto und Lücken in der Infrastruktur, muss man doch realistisch sein“, sagt Müller. Ihre Folgerung: „Wir haben deshalb unter anderem eine Anpassung des Reduktionsziels für das Jahr 2035 auf minus 90 Prozent vorgeschlagen“ – statt der bisher geforderten Verringerung des CO2-Ausstoßes um 100 Prozent. „Statt das Verbrenner-Aus – das auch bei den Verbrauchern Abwehrreflexe auslöst – wie eine Monstranz vor sich herzutragen, sollte man sich in Brüssel lieber darum kümmern, wie die Klimaziele tatsächlich erreicht werden können: Ladeinfrastruktur, bessere Stromnetze, eine bessere Rohstoffversorgung und so weiter.“
Bestätigt sieht sich die oberste Vertreterin der deutschen Autoindustrie dabei von den Ergebnissen der Allensbach-Umfrage: Nur 22 Prozent der Befragten gaben an, für sie käme ein Elektroauto infrage, 17 Prozent zeigten sich unentschieden, 60 Prozent lehnten dagegen die Option eines Elektroautos ab, nur zwei Prozent sagten, sie hätten schon eines.
Interessant war dabei allerdings, dass die derzeitigen Besitzer von Elektroautos das Angebot mit Lademöglichkeiten deutlich besser beurteilten als die Gesamtheit der Befragten. So fanden 26 Prozent der E-Auto-Besitzer die Ladeinfrastruktur an Landstraßen und Autobahnen gut, 61 Prozent weniger gut oder gar nicht gut. Insgesamt – wenn also nicht nur die Besitzer von Elektroautos, sondern die gesamte Bevölkerung befragt wird – antworteten nur 14 Prozent der Befragten mit einem guten Urteil, 38 Prozent der Befragten fanden die Lademöglichkeiten weniger gut oder gar nicht gut, zugleich antworteten 48 Prozent aller Befragten, sie könnten die Lage gar nicht einschätzen.
Hildegard Müller sieht da auch als Hürde, das viele Autofahrer einfach noch keine eigenen Erfahrungen mit Elektroautos gesammelt hätten. „Wichtig ist es, offen zu sein, auch mal ein Elektroauto zu testen. Ich höre oft, wie begeistert die Menschen sind, wenn sie es einmal ausprobiert haben.“
Dennoch hält sie den Ausbaustand der Ladeinfrastruktur für ernüchternd: „In Deutschland haben ein Drittel der Kommunen gar keine Ladesäule, zwei Drittel keine Schnellladesäule. Und der Ausbau der Stromnetze hängt auch hinterher, da ist auch die Energiewirtschaft gefragt.“ Noch schlimmer sehe es in anderen europäischen Ländern aus: „Ein Beispiel: Hamburg hat mehr Ladepunkte als Bulgarien. Die EU hat also den einzelnen Staaten viel zu geringe Vorgaben für den Ausbau der Ladeinfrastruktur gemacht.“ Da zeige sich, dass der Weg falsch sei, wenn die EU frei irgendwelche Ziele festsetze und Sanktionen, wenn die Ziele nicht erreicht würden: „Es geht doch nicht darum, die strengsten Ziele der Welt zu haben, sondern darum, die besten Chancen dafür zu schaffen, dass die gewünschte Veränderung auch erreicht werden kann, und gleichzeitig Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze zu erhalten.“
Solche Widersprüche ließen sich bis auf die Ebene einzelner Unternehmen verfolgen: „Wenn ein Transportunternehmer seinen Fuhrpark auf Elektroautos umstellen will, der Energieversorger aber sagt, dass das Stromnetz auf dem Betriebshof erst in zehn Jahren ausreichend für Lkw-Ladesäulen ist, warum wird dann die Automobilindustrie mit Strafen belegt – und der Transportunternehmer mit CO2-Maut?“
Obwohl die Zukunft der Mobilität „weit, weit überwiegend elektrisch“ sein werde, könne der Elektroantrieb nicht die einzige Lösung sein. „Wir brauchen mehr Optionen zur Senkung der CO2-Emissionen und auch zur Sicherung der Arbeitsplätze“, verlangt die VDA-Präsidentin. „Wenn in aller Welt Plug-in-Hybride gebaut werden und wir in Deutschland diese Kompetenz haben, wieso muss das in Europa politisch quasi verunmöglicht werden? Um hier Tausende von Arbeitsplätzen zu verlieren, die anderswo aufgebaut werden? Und auch klimaneutrale Kraftstoffe müssen genutzt werden, um die Emissionen zu verringern. Brüssel darf nicht mit der Scheuklappe agieren.“
Ebenso wenig findet es Müller angebracht, wenn in der öffentlichen Diskussion ganz generell die Nutzung von Autos negativ bewertet wird. 75 Prozent der Befragten in der Allensbach-Umfrage hielten das Auto für unverzichtbar, in den Dörfern sogar 84 Prozent. Und 71 Prozent antworteten, eine Veränderung ihres Mobilitätsverhaltens sei nur schwer möglich. „Gute Verkehrspolitik gelingt nicht aus dem urbanen Elfenbeinturm heraus. Gute Verkehrspolitik hat alle Lebensrealitäten im Blick, auch die von Menschen in ländlichen Regionen“, sagt Müller. Schließlich lebten mehr als die Hälfte der Deutschen auf dem Land und in Kleinstädten, und immer mehr müssten wegen der hohen Mieten in den Großstädten aufs Land ziehen. „Individuelle Mobilität, auch mit dem Auto, bedeutet Teilhabe. Deswegen darf man sich nicht wundern über die Unzufriedenheit von Menschen gerade in Kleinstädten und auf dem Land, die sich abgehängt fühlen, weil dort der Staat seinem Versorgungsauftrag mit öffentlichem Nahverkehr nicht mehr nachkommt.“
Bei der Weiterentwicklung des öffentlichen Nahverkehrs dürfe allerdings nicht in den alten eingefahrenen Bahnen gedacht werden, meint VDA-Präsidentin Hildegard Müller: „Wir brauchen nicht überall den großen Gelenkbus. Eine Perspektive bieten auch autonomes Fahren mit kleinen Rufbussen. Da müssen wir überlegen, wo Investitionen nötig sind und wo Innovationen gefördert und regulatorische Hürden beseitigt werden müssen. Da geht es nicht immer nur um mehr Geld, sondern auch um die Chancen mit dem Autonomen Fahren, wo deutsche Hersteller ganz vorne dabei sind. Gerade die bevorstehende Mobilitätsmesse IAA in München wird auch viele Testfahrten mit autonomen Fahrzeugen anbieten.“