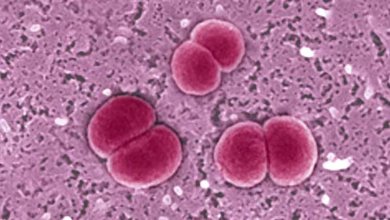Berliner Kulturförderung: Kein Luxus, sondern ein Muss | ABC-Z

Wer in Berlin Kunst macht, handelt oft aus Leidenschaft – und nicht selten gegen jede betriebswirtschaftliche Vernunft. Viele freie Kulturakteur*innen arbeiten projektweise, hangeln sich von Ausstellung zu Ausstellung, von Premiere zu Premiere, von Konzert zu Konzert.
Rechnete man ihre tatsächliche Arbeitszeit ehrlich zusammen – also kreatives Tun plus Konzeptentwicklung, Antragslyrik, Öffentlichkeitsarbeit und Buchhaltung –, lägen sie in den meisten Fällen unter dem gesetzlichen Mindestlohn. Und das in einer Stadt, deren Vermieter sich längst nicht mehr an die Legende vom billigen Berlin erinnern. Die Lebenshaltungskosten steigen, die Honorare stagnieren.
Vor diesem Hintergrund bekam dieser Montagabend im Deutschen Theater eine fast historische Wucht. Hier wurde der erste Entwurf eines Berliner Kulturfördergesetzes vorgestellt – kein Feuilletontraum, sondern ein handfestes Regelwerk in spe. Die Initiative wurde bereits 2021 gegründet, seit 2023 gab es erste Überlegungen Berliner Kulturverbände.
Im April 2025 begann dann der Beteiligungsprozess, maßgeblich vorangetrieben vom Verein Berliner Kulturkonferenz und gefördert vom Senat für kulturelle Angelegenheiten und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Fünfzehn Fachgruppen mit mehr als 120 Beteiligten aus allen Sparten, von der freien Szene bis zur kulturellen Bildung, erarbeiteten den 150 Seiten starken Entwurf. Besonders Bereiche, die vom aktuellen Sparkurs überproportional gebeutelt sind, saßen mit am Tisch.
Andere Städte sind klüger; Hamburg etwa gibt anteilig deutlich mehr für Kultur aus
Denn der finanzielle Hintergrund ist unerfreulich: Der Berliner Kulturbereich muss mit Einsparungen von weit mehr als 100 Millionen Euro umgehen – überproportional, schmerzhaft. Andere Städte sind klüger: Hamburg etwa gibt anteilig mehr für Kultur aus. Dass Kürzungen zuerst jene treffen, die ohnehin prekär arbeiten, ist keine Überraschung, sondern strukturelle Logik. Wenn Projektmittel schrumpfen, schrumpfen Honorare. Wenn Häuser sparen, sparen sie an der freien Szene. Und wenn Vielfalt vom Zufall abhängt, verliert am Ende die Stadt.
Es geht um bescheidene Mindeststandards
Worum geht es also? Um nichts weniger als bescheidene Mindeststandards, die nicht von Doppelhaushalt zu Doppelhaushalt neu verhandelt werden müssen. „Berlin ist nicht die Vorreiterin in Sachen Kulturfördergesetz“, sagt Wibke Behrens, Vorstand der Berliner Kulturkonferenz, mit nüchterner Klarheit zur taz. Doch gerade der breite Schulterschluss von über 60 Verbänden sei in Berlin entscheidend: „Er schafft Planbarkeit, Verlässlichkeit und auch ein Selbstbewusstsein der Akteur*innen, die mehr sind als Lobbyisten und Antragsstellende.“
Zentrale Forderung ist, dass künftig nicht mehr rund zwei, sondern drei Prozent des Landeshaushalts in Kultur fließen. Das klingt nach einer Marginalie, ist aber politisch ein Kraftakt. Hinzu kommen Mindesthonorare für alle Kulturakteur*innen, Tarifbindung in institutionell geförderten Häusern, die Dynamisierung von Honoraren und Gehältern sowie eine Begrenzung freier Arbeitsverhältnisse. Berichtspflichten über Gender Pay Gaps sollen Transparenz schaffen. Und schließlich die Frage, die man in kulturpolitischen Werbeblöcken gern umschifft: Wie ist die Altersarmut einer ganzen Berufsgruppe noch zu verhindern?
Interessant ist auch der Vergleich des Entwurfs mit dem Berliner Sportfördergesetz
Ein anderer Kernpunkt des Entwurfs ist Raum – jene kostbare Ressource, die in Berlin genauso umkämpft ist wie bezahlbarer Wohnraum. Arbeits- und Präsentationsorte sollen vom Berliner Arbeitsraumprogramm genauso gesichert werden wie deren Verwaltung. Außerdem soll es zwei neue Kulturhäuser für freie Musik und Tanz geben. Kulturakteur*innen sollen bei runden Tischen zur Stadtentwicklung, beim Schulneubau oder selbst bei unvermeidlichen Sparrunden mitreden.
In einer Stadt, in der mögliche Kulturhäuser nach kostspieligen Beteiligungsprozessen und parlamentarischer Diskussion bisweilen dann doch per Handschlag und jenseits großer Öffentlichkeit vergeben werden – man denke an die Alte Münze –, scheint das noch immer keine Selbstverständlichkeit.
Interessant ist auch der Vergleich mit dem Berliner Sportfördergesetz, den der Entwurf des Kulturfördergesetzes immer wieder zieht. Warum, so die implizite Frage, wird der Breitensport selbstverständlich unterstützt, die Breitenkultur jedoch oft als schmückendes Beiwerk behandelt? Kultur ist eben nicht nur „Leistungssport“, also Hochglanzentertainment für zahlungskräftiges Publikum.
Sie ist Chorprobe im Kiez, Theater-AG in der Schule, Tanzworkshop im Jugendzentrum, Senior*innenatelier im Nachbarschaftshaus. In Zeiten gesellschaftlicher Erosion und demokratischen Ermüdungserscheinungen sind niedrigschwellige kulturelle Angebote kein Luxus, sondern ein Muss. So wie Sportplätze öffentlichen Raum beanspruchen dürfen, sollten auch öffentliche Liegenschaften Kulturinitiativen dauerhaft oder temporär kostenfrei zur Verfügung stehen, wenn diese nicht gewinnorientiert arbeiten.
Ein Kulturfördergesetz wäre keine ökonomische Forderung, sondern ein gesellschaftlicher Vertrag
CDU und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, ein Kulturfördergesetz auf den Weg zu bringen. Die nun vorgelegten Publikationsbeiträge sind als Zwischenschritt gedacht; 2028 könnte ein Gesetz tatsächlich in Kraft treten. Beim Abend im Deutschen Theater hat die zuständige Senatorin, Sarah Wedl-Wilson, positiv reagiert. Man darf das als höflichen Optimismus deuten – oder als ernstgemeintes Signal.
Der vielleicht entscheidende Begriff, der über dem Entwurf schwebt, ist „Normalisierung“. Was überall gilt, sollte auch im Kulturbereich, der für das Wohl dieser Stadt so unverzichtbar ist, normativ gelten: faire Arbeit zu fairem Lohn inklusive Arbeits- und Kündigungsschutz. Ein Kulturfördergesetz wäre damit nicht bloß eine ökonomische Forderung, sondern ein gesellschaftlicher Vertrag.
Es würde festschreiben, dass Kultur kein Ornament ist, das man in Haushaltskrisen als Erstes abschlagen kann. Dass die Stadt kein Biotop für Kreativwirtschaft werden möchte, in der heroische Selbstausbeutung und das Recht des Stärkeren gilt, sondern die Bedingungen zur Produktion nachhaltiger Kunst von vielen schaffen möchte. Daher ist der Entwurf ein großer Schritt in die richtige Richtung. So groß, dass er nach dem Abend im Deutschen Theater lang erinnert werden wird.