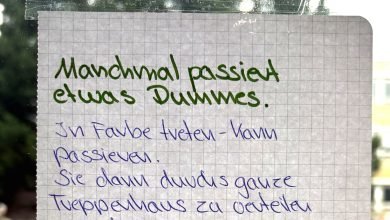Unterbringung von Geflüchteten: „Die Quittung werden wir bekommen“ | ABC-Z

taz: Herr Hermanns, das erste Containerdorf Deutschlands in Köpenick, das der Internationale Bund sechs Jahre geleitet hat, wurde gerade nach zehn Jahren geschlossen. Wie sehen Sie diese Einrichtung im Nachhinein?
Peter Hermanns: Es gab damals von allen Seiten Kritik. Einmal an dieser neuen Art der Unterbringung, zum anderen von der rechten Seite, die überhaupt gegen ein Heim war und dagegen demonstrierte. Zu Ersterem: Auch ich bin damals davon ausgegangen, dass Container nur eine vorübergehende Unterbringungsmöglichkeit sein können. Inzwischen sind sie aber eine normale Form der Flüchtlingsunterbringung – immerhin ist ihre Qualität besser geworden. Andererseits: Im Vergleich mit Großunterkünften wie Tegel und Tempelhof sind die Container in der Alfred-Randt-Straße fast besser gewesen.
taz: Inwiefern?
Hermanns: In den Containern der Notunterkunft in Tempelhof haben die Bewohner viel weniger Platz: 4 Menschen müssen in einem 12-Quadratmeter-Container leben. In Tegel in den Großzelten, die gerade abgebaut wurden, war es noch enger. In Köpenick beziehungsweise in anderen Containerdörfern, die reguläre Unterkünfte sind, sind es 15-Quadratmeter-Container für je 2 Menschen. Ich will das Containerdorf in Köpenick nicht schönreden. Ich glaube aber, dass man, wenn man eine gute und engagierte Arbeit macht – und diese Rückmeldung haben wir von ganz vielen Bewohnenden bekommen –, dann kann sich auch bei so einer prekären Unterkunft ein Gefühl von Sich-angenommen-Fühlen, von Wohlfühlen entwickeln.
Bild:
Privat
Im Interview: Peter Hermanns
62, ist Diplom-Sozialpädagoge, Buchhändler und Journalist. Zwischen 2014 und 2021 leitete er das erste Containerdorf Deutschlands für Geflüchtete in Berlin-Köpenick. Seitdem ist er Pressesprecher beim Internationalen Bund (IB) Berlin-Brandenburg.
taz: Warum sind Containerdörfer inzwischen normal? Liegt das nur an der Wohnungsnot – oder sind das politische Entscheidungen?
Hermanns: Inzwischen denke ich, das ist eine politische Entscheidung. Kurz nach der Eröffnung der Alfred-Randt-Straße haben wir begonnen, mit der Wohnungsbaugesellschaft Degewo ein Neubauprojekt in Altglienicke zu entwickeln, wo 50 Prozent Menschen mit und 50 Prozent ohne Fluchthintergrund zusammen leben. Bis heute bieten wir dort Beratungs- und Nachbarschaftsarbeit an – und das funktioniert. Wieso ist niemand sonst auf die Idee gekommen, so etwas anzuschieben? Wir brauchen ja händeringend mehr Wohnraum – für Geflüchtete und Nicht-Geflüchtete. Ich habe den Verdacht, dass es gar nicht mehr gewollt ist, dass Geflüchtete in Berlin wirklich dauerhaft ankommen. Die allgemeine Stimmung ist ja eher auf Abschieben raus.
Wir geben wahnsinnig viel Geld aus für eine Unterbringung in sehr prekären Verhältnissen
taz: Und der Senat hat kürzlich das Ziel einer dezentralen Unterbringung beerdigt und setzt nun allein auf Großunterkünfte und Hostels.
Hermanns: Dabei ist das ja viel teurer! Und vor allem geht es in den Hostels nicht um die Unterstützung der Menschen, da geht es nur um die Unterbringung. Ich frage: Was machen wir da eigentlich? Wir geben wahnsinnig viel Geld aus für eine Unterbringung in sehr prekären Verhältnissen. Und wir leisten keine Unterstützung mehr oder nur noch rudimentär. Die Quittung werden wir bekommen.
taz: Was meinen Sie damit?
Hermanns: Ich glaube, wenn Menschen so prekär untergebracht sind, wenn sie keine Unterstützung bekommen, die sie gerade am Anfang dringend brauchen, dann entwickeln sich natürlich Frust und Perspektivlosigkeit. Mit allen Folgen, die man sich ausmalen kann. Und dann wird die Diskussion noch mal verstärkt über diese angeblich so „problematischen“ Menschen, die nach Deutschland kommen. Ich glaube, die Politik versäumt es in weiten Teilen, dieser Erzählung von den Gefahren durch Geflüchtete etwas entgegenzusetzen. Obwohl man weiß, was Bedingungen sein könnten, um die Dinge erfolgreicher zu gestalten. Das haben wir mit der Alfred-Randt-Straße auch ein bisschen vorgemacht.
taz: Und wie läuft es in „Ihrer“ Notunterkunft in Tempelhof, die Sie zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt betreiben?
Hermanns: Ja, die ist sehr groß geworden inzwischen. Es gibt wie gesagt diese kleineren Container in den Hangars 1 bis 3 und weitere auf dem Parkplatz vor dem Gebäude. Insgesamt leben dort rund 1.400 Menschen – und es sollen ja nächstes Jahr noch mehr Container dazukommen. Das war auch mal als Kurzunterbringung geplant, aber viele Menschen leben da sehr lange, manche über ein Jahr.
taz: Wie kann man unter diesen Bedingungen als Betreiber gute Arbeit leisten?
Hermanns: Wenn man gut strukturiert und engagiert arbeitet und ein Konzept dahinter steckt und wenn man eine Zugewandtheit den Menschen gegenüber hat, kann man in allen Einrichtungen gut arbeiten. Aber je schwieriger die räumlichen Bedingungen sind, umso schwerer ist es eben auch.
taz: Was sind die größten Probleme?
Hermanns: Das fängt damit an, dass sich im Grunde genommen alle über das Essen beschweren. Das ist normal, weil: Für so viele Menschen Essen zu kochen, das allen schmeckt, das geht ja gar nicht. Das ist in allen Einrichtungen so. Dazu kommt die fehlende Privatsphäre. Wenn man mit drei fremden Leuten in einem Container schläft, dann hat man nie Ruhe. Das macht die Menschen kaputt.
taz: Und warum ist das so teuer?
Hermanns: Tempelhof ist im Betrieb gar nicht so teuer, kein Vergleich mit Tegel oder den Hostels. Aber natürlich war die Einrichtung der Hangars mit den Containern am Anfang ein dicker Batzen.
taz: Es war ja seit der Zeit von Elke Breitenbach als linke Integrationssenatorin Politik des Senats, bei Ausschreibungen für Flüchtlingsunterkünfte nicht nach dem günstigsten Preis zu gehen, sondern Betreiber zu berücksichtigen, die sozial- und integrationspolitische Konzepte vorlegen. Gilt das noch?
Hermanns: Nein, schon seit etwa zwei Jahren nicht mehr. Nur noch der günstigste Preis entscheidet, wer den Zuschlag bekommt. Das ist ja das Problem, dass gute Betreiber – und ich zähle uns jetzt einfach mal dazu – kaum noch eine Chance haben. Weil wir unsere Mitarbeitenden gut bezahlen nach Tarifvertrag, weil wir gute Arbeitsbedingungen schaffen wollen, weil wir seriös arbeiten. Wir verlieren Unterkünfte in Ausschreibungen und es kommen auch keine neuen dazu. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), das darüber entscheidet, möchte ich aber in Schutz nehmen. Das sind Vorgaben aus der Politik.
taz: Aber wie passt das zusammen? Das LAF soll immer die günstigsten Betreiber auswählen, gleichzeitig setzt der Senat mit Großunterkünften und Hostels auf die teuerste Art der Unterbringung.
Hermanns: Ich glaube, Letzteres liegt daran, dass es in den Kiezen keine Akzeptanz mehr für eine dezentrale Unterbringung gibt. Und jetzt kommt der Wahlkampf auf uns zu, da will sich niemand die Finger verbrennen. Auf wenige, zentrale Großunterkünfte zu setzen, ist halt die einfachste Lösung – egal wie viel Geld es kostet. Das hat auch damit zu tun, dass die Politik in Teilen den rechten Erzählungen nichts entgegensetzt, sondern ihnen im Grunde genommen hinterherläuft – in der Hoffnung, so die AfD klein zu kriegen. Das wird aber nicht passieren.
taz: Alles keine guten Aussichten, auch nicht für den IB, oder?
Hermanns: Wir sind ein sozialer Träger, der Menschen in Notsituationen hilft, nicht nur Geflüchteten, sondern auch Wohnungslosen, Jugendlichen, Menschen mit Beeinträchtigung etc. Es gibt immer genügend zu tun, und als Betreiber werden wir uns vielleicht anderen Bereichen mehr zuwenden. Aber was in der Flüchtlingspolitik passiert, ist, dass den Menschen offenbar nicht mehr die Unterstützung zuteilwerden soll, die sie brauchen. Was ich als Bürger nicht gut finde. Wir müssen endlich mal wieder dahin kommen, die ganz vielen positiven Beispiele nach vorne zu stellen von Menschen, die sich hier eine Existenz aufgebaut haben, die Steuern bezahlen, all das. Denn die haben jetzt Angst, dass sie hier trotz aller Bemühungen keine Zukunft haben sollen.