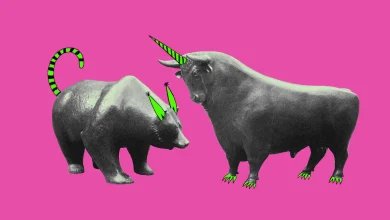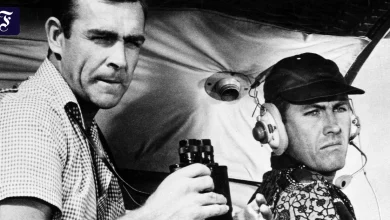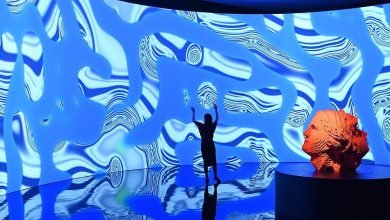Gespräch zu Kinos in Berlin: „Wir haben Chancen, wenn wir stärker an einem Strang ziehen“ | ABC-Z

Im Berlin der 2010er Jahre eröffneten drei unabhängige Programmkinos, als viele Kinos der Stadt längst schließen mussten: Il Kino, Wolf und Kino Zukunft. Zehn Jahre später gibt es sie immer noch. Zeit für eine Bestandsaufnahme mit den Betreiber:innen Carla Molino, Verena von Stackelberg und Sven Loose.
taz: Frau Molino, Frau von Stackelberg, Ihre Kinos liegen wenige Kilometer voneinander entfernt. Spricht man sich ab in Sachen Programm, damit keine Kannibalisierungseffekte entstehen?
Carla Molino: Meine Entscheidung, einen Film zu zeigen, rührt nur daher, dass ich ihn mag oder bekomme. Ich glaube, dass wir nicht wirklich im Wettbewerb stehen. Man kann dem Film nur Gutes bringen, wenn wir beide ihn spielen.
Verena von Stackelberg: Je mehr Angebot es gibt, desto mehr fördert man die Cinephilie und dass das Publikum häufiger ins Kino geht. Das zeigt auch die Cineville-Mitgliedschaft, die es in Deutschland seit einem Jahr gibt, aber auch in anderen Ländern. Weil es mit diesem Abo so leicht ist, ins Kino zu gehen, und zwar in jedes Arthousekino der Niederlande, tun die Leute das dort häufiger und sind experimentierfreudiger damit, welche Filme sie aussuchen. Das ist der Beweis dafür, dass wir uns nicht kannibalisieren, sondern eher ergänzen. Seid ihr auch Teil von Cineville?
Molino: Ja.
Sven Loose: Es gibt ja mindestens zwei Abo-Modelle, auch Cinfinity. Wir sind nirgendwo dabei.
Im Interview: Carla Molino, Verena von Stackelberg, Sven Loose
Nach dem Vorbild des Il Kino in Rom eröffnete Carla Molino 2014 ihr gleichnamiges Kino in einer früheren Bäckerei in der Nansenstraße. Das Konzept aus Programmkino mit angeschlossener Bar und Bistro und Filmen in Originalversion war neu im Kiez. Heute kommen die Gäste auch aus Spandau nach Neukölln, um einen Film zu sehen. Auch deshalb brauche man eine enge Bindung zu den gezeigten Filmen und müsse sie im Zweifelsfall verteidigen können, sagt Molino.
Mithilfe eine Crowdfunding-Kampagne und helfenden Händen aus der Nachbarschaft baute Verena von Stackelberg ein stillgelegtes Bordell zum Kino um, das 2017 offiziell eröffnete. Das Wolf in der Weserstraße versteht sich als Kulturort, der Filmschaffende und Publikum zusammenbringt und Bildungsarbeit für Schulen und Kitas leistet. Die Vorstellungen laufen in Originalversion, davor und danach kann man im dazugehörigen Café zusammensitzen.
Das Kino Zukunft eröffnete 2012 als Teil des Kollektivs Zukunft am Ostkreuz. 2023 musste das Kollektiv den Standort wechseln, jetzt findet man das Kino Zukunft und das dazugehörige Freiluftkino in Alt-Stralau 68. Sven Loose, der auch das Programm für die nahe gelegenen Tilsiter Lichtspiele und Intimes macht, sagt, jeder Standort brauche ein eigenes Programm. An der neuen Adresse des Kino Zukunft liefen Politisches und Filme mit Musikbezug am besten.
von Stackelberg: Wir müssen reden (lacht). Das ist der Fehler in Deutschland, dass man zwei Abos gleichzeitig eingeführt hat.
taz: Sie alle haben zu einer Zeit eröffnet, als größere, aber auch kleinere Berliner Kinos bereits schließen mussten. Wie stellt sich Ihre Lage heute dar?
Einen Klassiker einmal zu zeigen, kann bis zu 500 Euro kosten. Das macht meine Vorstellung davon, wie wir mit Filmgeschichte umgehen, schon etwas kaputt.
Verena von Stackelberg
Loose: Ich würde sagen, wie vorher auch. Wir machen das ja seit Anfang der Neunziger, ursprünglich als Clique von jungen Leuten in den wilden Zeiten im Osten. Es kamen weitere Standorte dazu, immer selbst gebaut. Damals war die Entwicklung nicht abzusehen, außer man hatte vorgerechnet und prognostiziert. Dann trat das ein: Man brauchte mehrere Standbeine, etwa, wenn ein Vertrag nicht verlängert oder die Miete stark angehoben wurde. Das sind die Gründe, warum ein Kino heutzutage schließen muss.
Molino: Mein Kino war das erste, das nach der Wende neu gebaut wurde. Ich habe viele Komplimente bekommen. Zur Filmauswahl, der Ausstattung, dazu, wie nett wir waren. Das hat mir Kraft gegeben, mich zu entwickeln und professioneller zu werden. Ich hatte 2019 über 22.000 Zuschauer, das ist viel für einen Saal mit 52 Plätzen. Nach der Pandemie wieder anzufangen, war komplizierter.
taz: Abgesehen von der Pandemie: Wo lief das Kinomachen anders als geplant oder erhofft?
von Stackelberg: Ich habe in London als Kartenabreißerin gearbeitet und den Übergang von analogen zu digitalen Projektionen erlebt. Meine Theorie ist: Durch den Wegfall der analogen Projektion musste sichergestellt werden, dass man weiter Geld damit macht. Die neuen Projektoren sind sehr teuer und müssen alle fünf Jahre aufgerüstet werden. Gleichzeitig ist es durch die Verschlüsselung der Filme teuer, digitale Kopien zu kaufen. Meine Hoffnung war, dass ich viel mehr Filmgeschichte zeigen kann. Das ist kaum möglich, weil die Sachen nicht digitalisiert worden sind oder eine einmalige Vorführung um die 150 Euro kostet für Verschlüsselung und digitales Cinema Package. Dazu die Rechte für den Film selbst. Einen Klassiker einmal zu zeigen, kann bis zu 500 Euro kosten. Das macht meine Vorstellung davon, wie wir mit Filmgeschichte umgehen, schon etwas kaputt.
Molino: Ich dachte, ich bringe viel mehr unabhängige Filme aus dem Ausland hierher. Es ist leider unmöglich, das zu bezahlen mit 52 Plätzen, die man verkaufen kann.
von Stackelberg: An die analogen Kopien kommt man wiederum nicht ran, weil sie nur noch an Museen verliehen werden. Viele Kopien wurden zerstört, weil sie Platz brauchen und die Filmlager nicht mehr da sind. So passieren ständig kleine Tode und Neuentstehungen in der Kinowelt.
taz: Welche Neuerungen zum Beispiel?
von Stackelberg: Etwa, dass jüngere Leute jetzt Klassiker im Kino sehen wollen. Dank Park Circus und weiteren Firmen, die Rechte und digitale Kopien verteilen, ist es teilweise wieder leichter geworden, an Klassiker zu kommen. Aber das ist sehr westlich und englischsprachig limitiert. Dazu gibt es Bewegungen wie die Onlineplattform Letterboxd über die junge Leute, die Filmgeschichte neu erleben.
taz: Worin sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen Ihrer Branche?
von Stackelberg: Die Unberechenbarkeit der Kosten wird immer schlimmer. Dann ist Krieg in der Ukraine und die Stromkosten sind exorbitant. Auch die Wareneinsatzkosten und Personalkosten steigen. Dazu diese Unverlässlichkeit der Förderung, also, dass der Staat immer weniger investiert, weil er lieber Waffen kauft. Besser, man hat seine eigenen Einkommensquellen, mit denen man verlässlich arbeiten kann. Und wenn ich noch etwas sagen darf?
taz: Bitte.
von Stackelberg: Ich finde es höchst problematisch, dass es eine Kinokette gibt, die ein Flatrate-Abo hat, das dazu führt, dass alle, die nur zu diesen Kinos gehen, quasi gar nicht mehr die anderen Kinos besuchen.
taz: Sie meinen die Yorck-Kinogruppe?
von Stackelberg: Ja. Ich finde, wir sollten uns in Deutschland als unabhängige Kinos zusammenschließen und alle das gleiche Abo haben. In Ländern, wo das gemacht wurde, etwa den Niederlanden, ist die Erfolgsrate unfassbar. Wir haben schon Chancen, den Kinomarkt maßgeblich zu verbessern und zu verändern, wenn wir stärker an einem Strang ziehen.
taz: Teilen die anderen diese Einschätzung?
Molino: Ich sehe das genauso. Diese Kette will Filme auch oft exklusiv haben. Abgesehen davon sind spontane Kosten ein Problem: Die Kaffeemaschine geht kaputt oder ein Fenster. Das muss man Ticket für Ticket verdienen.
taz: Sie waren unter den Gewinner:innen des diesjährigen Kino-Programmpreises, der vom Medienboard Berlin Brandenburg vergeben wird. Il Kino und Wolf haben Prämien von je 40.000 Euro erhalten, das Kino Zukunft 15.000. Wofür haben Sie die eingesetzt?
Molino: Ich habe es für den Sommer gebraucht. Da war zwar geschlossen, aber Miete, Strom, Versicherung wurden weiter gezahlt. Und wir haben mit einer Förderung die Sessel renoviert. 60 Prozent wurden gefördert, den Rest zahlt man selbst.
taz: Ist es leichter mit mehreren Standorten, Herr Loose?
Loose: Das ist alles prekär bei den bescheidenen Sitzplatzkapazitäten. Da bräuchte man schon dreistellige Plätze pro Leinwand. Aber bei uns sind alle super engagiert und voller Elan. Was mir eher Sorge bereitet in Berlin, ist, mittel- bis langfristige bezahlbare Mieten zu finden. Mit mehrere Standorten merkt man, wie man sich immer wieder das Wohlwollen der Vermieter sichern muss und wie schnell das wegbrechen kann.
von Stackelberg: Die GLS vergibt Darlehen zur Sicherung von Kulturstandorten. Darüber haben wir Wolf, also die Erdgeschossimmobilie, die wir gemietet haben, gekauft. Unsere Vermieter haben uns ein gutes Angebot gemacht. Ich habe sechs Jahre daran gearbeitet.
taz: Wie viel arbeiten Sie denn durchschnittlich?
Molino: Sicher 16 Stunden pro Tag. Ich habe gleichzeitig mit dem Kino Zwillinge zur Welt gebracht. Deshalb sage ich immer, ich habe drei Kinder. Das Kino ist wirklich meine Kreatur, das ist kein Scherz.
Loose: Ich rechne gar nicht. Die Kinos sind mein Leben und mein Leben gehört den Kinos.