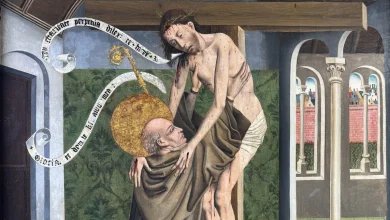Im Wald: Gesunder Boden ist ein Hotspot an Diversität – Bad Tölz-Wolfratshausen | ABC-Z

Nur bis zu 30 Zentimeter dünn ist die oberste und fruchtbarste Schicht des Waldbodens und damit leicht zu schädigen. Trotzdem muss Robert Nörr seinen Spaten im Wald nahe des Eglinger Ortsteils Neufahrn erst einmal kraftvoll in den Untergrund stoßen, um zwei rechteckige Blöcke an nur 20 Meter voneinander entfernten Standorten nach oben zu treiben. Doch genau das ist notwendig, um anschaulich zu machen, was einen möglichst gesunden Boden ausmacht.
Stabiler Wald ist Voraussetzung für einen gesunden Boden
Für den einen Block hat Nörr, der als staatlicher Revierförster für die Kommunen Icking, Wolfratshausen und Egling im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zuständig ist, in einen oberflächlich sattgrünen Moosboden unter reinem Fichtenwald gegraben. Der zweite rechteckige Quader stammt aus dem direkt angrenzenden, lichten Mischwald mit Laubbäumen wie dem Ahorn. „Mischwald ist ein stabiler Wald“, sagt Nörr. „Daraus resultiert ein gesunder Waldboden.“
Zwei Zentimeter dick ist in diesem Block nur die Streu aus herabgefallenen Nadeln, Laub und Ästen, welche die Bodenlebewesen zu fruchtbarem Humus zersetzen. Im Quader aus dem Fichtenwald sind es sieben Zentimeter bis zum dunklen Humus. „Im reinen Fichtenwald ist die Streu für die Bodenlebewesen schwer abbaubar“, sagt Nörr. Die Nadeln senken den ph-Wert im Boden, was ein saures Milieu zur Folge hat. Deshalb kommen dort auch weniger Bodenlebewesen vor, die sich zudem schwertun, die Nadelstreu in wichtigen Humus umzuwandeln.
Ein Teelöffel Erde hat mehr Mikroorganismen als es Menschen gibt
„Unter den Nadelbäumen ist der Boden viel komprimierter, weil er schlechter durchlüftet ist, weil es etwa nicht so viel Regenwürmer gibt“, ergänzt Forstingenieurin Maria Meixner, die für die Waldbesitzervereinigung (WBV) Wolfratshausen arbeitet und Nörr bei der Waldexkursion begleitet. Von beiden ist zu erfahren, dass in einem Quadratmeter gesunden Waldbodens in etwa 30 Zentimeter Tiefe um die 2,5 Billionen Mikroorganismen existieren. Auf einem Teelöffel Erde kommen demnach mehr Mikroorganismen vor, als die Erde menschliche Bewohner hat. „Der Waldboden ist ein Hotspot an Diversität“, sagt Meixner.
Fachleute bezeichnen die Gesamtheit aller Organismen im Boden als das sogenannte Edaphon. So weiten auch die Forstingenieurin und Nörr den Blick in knapp zwei Stunden, die sie durch den Wald bei Neufahrn führen, auf die Makroebene. Das Duo veranschaulicht, weshalb es so wichtig ist, gesunden Boden durch konsequente Waldpflege zu erhalten. „Der Waldboden ist die Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen“, sagt Nörr.
Und das in vielerlei Aspekten. Generell gilt, dass verschiedene Baumarten besser für den Boden sind als Monokulturen. „Allein die Mischung ist schon Gold wert“, sagt Meixner. Wichtig ist gesunder Waldboden zudem, weil dieser das Niederschlagswasser besonders gut reinigen kann, das langsam in tiefere Schichten versickert und als Trinkwasser gewonnen wird. Laut Nörr sei das normalerweise sogar ohne Aufbereitung direkt zu verwenden. „Ein Großteil des Trinkwassers wird in Deutschland unter Wald gewonnen.“
Gleichzeitig schützt Waldboden vor Erosion. Das spielt insbesondere in Zeiten des Klimawandels eine große Rolle, weil Starkregenereignisse zunehmen. So sorgen Bäume mit ihren Nadeln und Blättern dafür, dass die Niederschläge verzögert am Boden ankommen. Im gesunden, porenreichen Waldboden versickert das Wasser zudem langsamer, fließt nicht oberflächennah und in so großer Menge ab, wie auf versiegelten Flächen.
Den Wald zu pflegen, ist daher aus Sicht von Nörr und Meixner existenziell. Darunter fällt auch, Bäume zu fällen, damit andere mehr Entwicklungschancen haben. Den Wald einfach sich selbst zu überlassen, sei aber keine Option. Denn so kämen zwar in Jahrzehnten viel mehr Bäume auf. Doch werde der Wald durch besonders eng beieinander stehende Exemplare umso instabiler. Den Bäumen fehlt der Platz für größere und tiefer in den Boden reichende Wurzeln. Bei Sturm knickten Exemplare in solchen Waldflächen besonders schnell um, so Nörr. Auf den entstandenen Kahlflächen dauere es wieder Jahrzehnte, einen gesunden Wald aufzubauen.
Einsatz von schweren Maschinen ist Teil der Waldpflege
Zur Waldpflege zählt heutzutage ebenso der Einsatz von schweren Maschinen wie Lastwagen und Harvestern. Für einige sind die tonnenschweren Geräte allerdings kritisch, weil beim Befahren der darunter liegende Boden stark verdichtet wird. Für Bodenlebewesen ist das schlecht. Daher ist für Nörr das System aus Forstwegen und Rückegassen im Abstand von 30 bis 40 Metern so essenziell. Denn damit werde der restliche Waldboden geschont. „Ein Wald ohne Weg ist wie ein Haus ohne Tür“, sagt Nörr.
Seine Kollegin Meixner von der WBV Wolfratshausen ergänzt, dass etwa bei Borkenkäferbefall möglichst schnell betroffene Bäume entfernt werden müssten. Besonders in regenreichen Phasen entstünden viel mehr Bodenschäden, wenn es kein Wege- und Rückegassensystem gebe.
Eine wichtige Aufgabe hat der Wald auch als Kohlenstoffdioxidspeicher. 53 Prozent davon werden laut Nörr im Boden gebunden. Der Förster spricht zudem von einem „riesigen Einsparpotenzial“, wenn etwa besonders energieintensive Baustoffe wie Beton oder Aluminium zunehmend durch Holz ersetzt würden. „Ein Kubikmeter Holz speichert eine Tonne Kohlenstoffdioxid“, so Nörr. Wie Meixner ergänzt, bleibe sogar noch mehr davon längerfristig gebunden, etwa bei der Verarbeitung zu Möbeln.
Symbiose mit bestimmten Pilzen
Wie etwa Bäume über ihre Wurzelsysteme Nährstoffe austauschen oder sich über Duftstoffe gegenseitig vor Schädlingen warnen, hat etwa der Förster Peter Wohlleben durch Bücher einer größeren Öffentlichkeit bekannt gemacht. Generell seien der Waldboden selbst und viele darin ablaufende Prozesse laut Nörr und Meixner noch viel zu wenig untersucht und verstanden.
Wer den beiden zuhört, bekommt aber einen klaren Eindruck davon, wie faszinierend das unterirdische Zusammenspiel sein kann. „Die meisten Bäume haben eine enge Symbiose mit Mykorrhiza-Pilzen“, sagt Nörr. Diese wüchsen an den Wurzeln der Bäume, schützten vor anderen schädlichen Pilzen wie dem Hallimasch, der die Wurzeln schädigt. Laut Nörr helfen die Mykorrhiza-Pilze zudem den Bäumen, Nährstoffe aufzunehmen und erhielten dafür im Gegenzug Zucker. „Der Waldboden könnte ohne Mykorrhiza-Pilze nicht überleben“, so der Revierförster.
Was den Waldboden aber bedroht, sind seinen Angaben nach zunehmende Stickstoffeinträge. Dadurch werde das natürliche Gleichgewicht zerstört. Mykorrhiza-Pilze zögen sich zurück, wodurch das Nährstoffsystem geschädigt werde. „Bodenzustandserhebungen zeigen, dass 77 Prozent der Flächen die kritischen Werte überschritten“, so Nörr.
Seit 2018 nimmt die Waldfläche in Bayern durch zunehmende Bodenversiegelung ab
Ein weiterer kritischer Punkt ist die zunehmende Versiegelung, etwa weil der Boden und damit auch Wald immer weiter durch Infrastruktur überbaut wird. Laut Nörr hat der Wald in Bayern zwar seit dem Jahr 1977 in absoluten Zahlen zugenommen. Doch seit 2018 nahm die Waldfläche durch intensivere Versiegelung jährlich ab.
Wer nach knapp zwei Stunden mit Nörr und Meixner den Wald bei Neufahrn wieder verlässt, ist um viele Eindrücke zur Fragilität des besonderen Ökosystems und den Wechselwirkungen mit dem Boden reicher. Dafür wollte das Duo sensibilisieren, doch die beiden betonen auch, dass es sich nicht als missionarisch verstünden. Zum Thema solle sich jeder seine eigenen Gedanken machen, sagen sie.