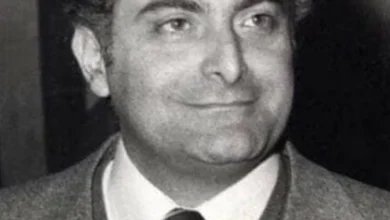Nach Hamas-Angriff: Wie das am stärksten zerstörte Kibbuz Nir Oz wächst | ABC-Z

In seinem Golfmobil rauscht Ron Bahat durch Nir Oz. Der 59 Jahre alte Israeli kennt sich blind aus in dem Kibbuz. Scheinbar ohne nachzudenken navigiert er durch die verwinkelten Fußwege, rauscht an grünen Rasenflächen, blühenden Büschen und mit Einschusslöchern versehrten Häusern vorbei. Geschwindigkeitsbegrenzungen ergeben sich nur durch die Leistung des Gefährts, Platzbeschränkungen kennt Bahat nicht – drei Personen und sein Hund werden neben- und übereinander auf die zwei Sitze des Wagens gestapelt.
Bahat grüßt hier, grüßt dort. Irgendwann kommt ihm sein Vater Natan entgegen – ein weißhaariger alter Mann, der den kleinen Kibbuz an der Grenze zum Gazastreifen vor fast 70 Jahren mitgegründet hat. Er wohnte in einem von nur sechs Häusern in Nir Oz, in die am 7. Oktober 2023 keine Hamas-Kämpfer eindrangen.
Kurzes Hallo, dann geht es weiter. Von irgendwo ruft jemand Bahat etwas zu, auf Hebräisch mit asiatischem Akzent. Ein Arbeiter mit einem Akkuschrauber sitzt auf dem Dach eines Verschlags. Bahat springt aus dem Wagen, steigt in einen Gabelstapler und fährt das Gabelgerüst hoch, auf das der Arbeiter klettert und sich herunterfahren lässt.
In Nir Oz passiert etwas. An einer Baustellte sagt Bahat, hier entstünden neue Häuser für Bewohner des Kibbuz. Mitte Dezember sollen sie fertig sein. „Das ist ziemlich ambitioniert“, sagt er. Aber Träume Wirklichkeit werden zu lassen, war schon immer ein Charakteristikum des Zionismus. Und was ist zionistischer als die Kibbuz-Bewegung?
Er kehrte nach dem Angriff postwendend zurück
Ron Bahat wirkt wie eine Verkörperung dieses Ideals. Ein großer, hagerer, sonnengebräunter Mann, direkt und unsentimental. Er ist in Nir Oz geboren. Am 7. Oktober „war ich unglücklicherweise hier“, stundenlang hielt er die Türklinke seines Schutzraums fest. Stunden später wurde er wie die übrigen Kibbuz-Bewohner evakuiert. Bahat machte jedoch postwendend kehrt und „half der Armee, das Gebiet zu sichern“. Dann machte er sich daran, im Kibbuz aufzuräumen. Etwas stolz sagt Bahat: „Ich bin der Einzige, der unmittelbar zurückkam und seither die ganze Zeit hier war.“
Inzwischen ist Bahat für alle Bauvorhaben im Kibbuz zuständig. „Wiederaufbau“, sagt er selbst – und meint das auch so: Denn Nir Oz wurde stark zerstört, so stark wie kein anderer der zwei Dutzend überfallenen Orte. Zahlreiche der von den Hamas-Terroristen verwüsteten Häuser sollen abgerissen, andere von Grund auf renoviert werden. Und der Ort soll erweitert werden.
Die Pläne und die Energie, die Leute wie Ron Bahat an den Tag legen, sind beeindruckend. Sie werfen aber auch Fragen auf. Vor einem halben Jahr hatte die F.A.Z. Niz Oz besucht – und einen Ort vorgefunden, der wie in der Zeit eingefroren wirkte. Vieles sah im Grunde so aus wie kurz nach dem 7. Oktober: abgebrannte, halb oder ganz zerstörte Häuser, Einschusslöcher, Rußspuren. Es gab Aushänge, die auf Veranstaltungen am 7. Oktober aufmerksam machten, und persönliche Gegenstände in den Wohnungen verschleppter Menschen.

Nir Oz war der Ort, in dem relativ zur Zahl der Bewohner am meisten Menschen ermordet oder entführt wurden: 120 – mehr als ein Viertel. Vor dem Speisesaal stehen Pappaufsteller derjenigen neun Bewohner von Nir Oz, die nach zwei Jahren immer noch im Gazastreifen festgehalten werden. Vier von ihnen könnten noch am Leben sein.

Die Wohnungen dieser Neun wurden seither nicht angetastet. Aber auch sonst waren die Spuren des Überfalls im Frühjahr allgegenwärtig – nicht nur an Gebäuden, auch an den Menschen konnte man sie ablesen. Viele rangen mit der Frage, wie es weitergehen könne – und wo.
Die Kibbuzgemeinschaft lebt übergangsweise in Kiryat Gat, etwa 60 Kilometer entfernt. Manche konnten sich eine Rückkehr an den Ort, mit dem schreckliche Erinnerungen verbunden sind, nicht vorstellen. Andere vielleicht schon. Viele waren unsicher, immer noch traumatisiert durch den Angriff, der Nir Oz und ganz Israel so unvorbereitet traf.
Die DNA von Nir Oz
Den Kibbuzmanagern sind die Ängste und Vorbehalte bewusst. Ron Bahat erzählt, in dem Team von Fachleuten, das sie zusammengestellt haben, um den Wiederaufbau zu planen, seien auch Traumaexperten. Nach vielen Diskussionen, auch mit den Bewohnern, sei man zu dem Schluss gekommen, dass die Besonderheit von Nir Oz in seiner Natur liege: Die Bäume, die von den Pionieren gepflanzt wurden – die verschlungenen Wege, auf denen Ortsfremde sich leicht verlaufen – die Grünflächen, auf denen Kinder ungefährdet spielen können.
„Die Landschaft ist die DNA von Nir Oz“, sagt Bahat. Gerade in einem Kibbuz, in dem die Wohnungen typischerweise klein sind, sei es wichtig, viel Zeit draußen verbringen zu können – und dennoch Intimität zu verspüren. Das wolle man erhalten. So werden einige Häuser jetzt renoviert oder neu gebaut, aber die kleinen Wege, die offenen Gärten und die beschauliche Atmosphäre sollen erhalten bleiben.
Aber das ist nur ein Teil der Zukunftspläne. Nir Oz solle „größer und stärker“ werden, sagt Bahat. In seinem Büro hängen mehrere Karten an der Wand. Aus der Luft sieht der Ort aus wie ein Halbkreis: Es gibt das Ortszentrum mit dem Speisesaal und anderen Gemeinschaftseinrichtungen, westlich davon sind Wohngebiete gruppiert. Auf einer der Karten ist dieser Halbkreis fast ein Kreis. Das ist der Plan, um Nir Oz wachsen zu lassen.

Östlich des Zentrums sollen ganz neue Wohnviertel entstehen. Vor dem 7. Oktober lebten dort etwa 400 Menschen. Nach den Vorstellungen der Kibbuzverwaltung sollen es mindestens doppelt so viele werden. „800 bis 1000 wäre eine gute Zahl, denke ich“, sagt Bahat. „Es wäre nicht zu viel. Man könnte die Intimität wahren – aber gleichzeitig ein paar mehr Dinge hier machen.“
Um Niz Oz insbesondere für junge Leute attraktiv zu machen, sollen zwei Colleges gegründet werden. Außerdem gibt es eine „Mechina“ – eine Institution, an der Abiturienten ein Jahr verbringen, bevor sie ihren Wehrdienst antreten. „So schaffen wir die Basis für den neuen Kibbuz“, sagt Bahat.
Sie haben einfach angefangen
An diesem großen Plan arbeiten sie jetzt mit voller Kraft. An zahlreichen Ecken und Enden des Kibbuz wird gebaut. Man sei gerade in der „Pionierphase“, erläutert Bahat. Neun Wohnungen seien schon von Grund auf renoviert worden, zwanzig weitere seien in Arbeit. Die Kosten für alles der Kibbuz auf 450 Millionen Schekel veranschlagt, rund 110 Millionen Euro.
Der Staat und andere Institutionen haben Gelder zugesagt, aber momentan gibt es noch eine Finanzierungslücke von 50 bis 70 Millionen Schekel. Der Kibbuz hat aber entschieden, dennoch mit der Umsetzung der Pläne zu beginnen. „Wir können nicht warten, bis die alle ihre Entscheidungen getroffen haben“, sagt Bahat mit Blick auf die Geber. „Bis dahin wären wir weg.“
Was er so nüchtern ausführt, hat für viele eine zutiefst emotionale Seite. Während des Gesprächs in Bahats Büro ist Yiftach Cohen hereingekommen. Er lebt woanders, stammt aber aus Nir Oz und kommt seit zwei Jahren immer wieder, um beim Wiederaufbau zu helfen. Als das Gespräch auf die Neujahrsfeier kommt, zu der fast 300 Bewohner sich vor ein paar Wochen in Nir Oz versammelt haben, sagt der 60 Jahre alte Mann: „Das war eine sehr emotionale Party“ – und kann die Tränen kaum zurückhalten. Die Stimmung sei gewesen: „Es wird wieder ein Kibbuz sein – es wird wieder eine Gemeinschaft sein.“ Auch Ron Bahat sagt, er habe zwei Jahre lang auf diesen Moment hingearbeitet.
Er fügt hinzu, ihm sei klar, dass es Bewohner gebe, die nicht zurückkommen werden. „Und das ist ok.“ Aber alle sollten wissen, „dass unsere Türen für sie offenstehen“. Jeder, der den Kibbuz in diesen Tagen besuche, sehe, dass es Veränderungen gebe, dass sich Dinge bewegten.
„Wiederbelebung“, auch durch junge Leute
In diesen Wochen die ersten Familien nach Nir Oz zurückgekehrt. Etwa Bahats eigene: Seine Frau und zwei seiner drei Töchter lebten seit einem Monat wieder hier, sagt er. Auch sein Vater Natan sei zurückgekehrt. Insgesamt lebten jetzt fast 70 Menschen permanent in Nir Oz. „Noch vor zwei Monaten war es praktisch niemand.“
Unter den Bewohnern sind auch welche, die vorher nicht in Nir Oz gelebt haben. Die Mechina, das Übergangsprogramm zwischen Schule und Armee, hat am 3. September die Türen aufgemacht. 24 junge Israelis studieren dort Themen wie israelische Geschichte oder jüdische Identität, arbeiten zwei Tage in der Woche aber auch im Kibbuz, etwa in der Küche oder in der Schreinerei. Es sei ein wichtiger Bestandteil des Aufenthalts, Teil der „Wiederbelebung“ von Nir Oz zu sein, erklärt der 43 Jahre alte Direktor Dani Levit, der selbst erst vor zwei Monaten hierhergezogen ist. Das hat offenbar einen Nerv getroffen: Es habe 120 Bewerbungen gegeben, berichtet er. Für das nächste Jahr hätten schon 700 Personen Interesse angemeldet.

Was bewegt junge Israelis dazu, an einen der am schlimmsten vom 7. Oktober betroffenen Orte zu ziehen, der halb verwaist ist und wenige Kilometer von einem Kriegsgebiet entfernt liegt – und in den nicht einmal manche Bewohner zurückkehren wollen? Als er von dem Programm gehört habe, „habe ich sofort gewusst, dass ich an keinem anderen Ort sein will“, sagt der 17 Jahre alte Zohar Sorek aus Ramat Gan.
Als er Juni erstmals in Nir Oz gewesen sei, habe er Detonationen gehört. Zuerst sei das furchterregend gewesen. „Aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran – und es hat meine Motivation, hier zu sein, noch verstärkt.“ Er wolle etwas dazu beitragen, dass die Bewohner zurückkehren und „das Leben haben können, das sie verdienen“. Für ihn sei das der stärkste Ausdruck davon, dass Israel seine Feinde besiegt habe.
Auch die ebenfalls 17 Jahre alte Sivan Yakir spricht davon, dass sie etwas tun wollte, das nicht nur ihr selbst diene. „Jeder Beitrag, und sei er noch so klein, hilft, die Orte rund um den Gazastreifen wiederaufzubauen.“ Beide berichten, die Umstellung sei groß gewesen. Aber das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe sei schon nach wenigen Wochen sehr groß. „Ich hatte einen der besten Monate meines Lebens“, sagt Yakir.
Die grauenvolle Geschichte des Ortes nehmen sie dabei durchaus wahr. „Jedes Mal wenn wir an diesen Häusern vorbeikommen, spüren wir die Brände“, sagt Yakir mit Blick auf einige der völlig abgebrannten Gebäude, die noch stehen. Sie verstehe dann auch, warum mache nicht zurückkehren wollten. „Wenn es schon mich schmerzt, kann man sich vorstellen, wie stark das bei ihnen sein muss.“ Der Direktor erzählt, man versuche, sicherzustellen, dass die Studenten nicht überwältigt werden. Aber natürlich könne man diese Realität nicht komplett ausblenden. „Es ist unmöglich, dass die Situation sie nicht emotional beeinflusst“, sagt Levit. Das Team spreche regelmäßig mit den Teenagern und achte darauf, wie sie reagieren.

Auf den ersten Blick scheinen die jungen Israelis nicht zuletzt überwältigt von dem Gefühl zu sein, einen Beitrag zum Wiederaufbau und damit zum zionistischen Ethos leisten zu können. Die Besiedlung insbesondere von Grenzgebieten spielte in der Geschichte Israels und auch vor der Staatsgründung eine wichtige Rolle. Auch heute ist das Land von dieser Ideologie geprägt, zugleich aber politisch tief gespalten.
Levit sagt, seine Mechina sei – anders als viele andere, die etwa mit religiösen Strömungen verbunden sind – unabhängig und habe „keine Agenda“. In Nir Oz angesiedelt zu sein, heiße aber, „dass wir der Gemeinschaft zur Seite stehen, was die Entführten angeht und die Forderung, sie alle zurückzubringen“. So hätten sie einmal an einer Demonstration der Kibbuzbewohner in Kiryat Gat teilgenommen. „Es war nicht verpflichtend“, sagt Levit, „aber alle sind gekommen.“
„Wir wollen einen Beitrag leisten“
So wird Nir Oz mit neuem Leben gefüllt. Neben den jungen Studenten ist auch eine Gruppe von Haschomer Hazair nach Nir Oz gezogen, einer sozialistisch-zionistischen Jugendorganisation. 35 Mitglieder werden die nächsten Jahre hier leben. Sie richten Häuser wieder her, die nur leicht beschädigt wurden, und helfen im Erziehungs- und Gesundheitsbereich. „Langfristig hoffen wir, dass wir irgendwann nicht mehr gebraucht werden“, sagt Oren Lew, „aber bis dahin wollen wir einen bedeutsamen Beitrag leisten.“ Der 29 Jahre alte Mann nimmt dafür sogar eine Fernbeziehung mit seiner Verlobten in Kauf. Bislang empfindet er die Menschen in Nir Oz als einladend. „Und mir persönlich macht der Lärm der Bombardierungen auch nichts aus.“
Natürlich könne man nicht ignorieren, was in Nir Oz geschehen sei, sagt Lew – der Horror sei sehr präsent. Aber die Gemeinschaft von Haschomer Hazair und das Bewusstsein um ihre Mission hier gäben ihm Halt. Er glaube, die Zukunft des Staates Israel werde „ebenso sehr in Nir Oz entschieden wie in Tel Aviv oder Jerusalem“. Er meint damit, dass man nach einem Ereignis wie dem 7. Oktober nicht einfach zusehen könne. In Nir Oz hoffe er zu zeigen und zu sehen, dass Leute ihre Zukunft selbst gestalten – „eine Zukunft von Leben, Frieden und Fürsorge“. Und außerdem, sagt er: „Nach jedem Krieg kommt Leben. Selbst wenn es schwer sein kann.“
Einige wird auch das womöglich nicht überzeugen. Eine Gruppe von 52 Familien hat schon im Frühjahr beschlossen, dass sie auch künftig an einem Ort zusammenleben möchte – aber nicht mehr in Nir Oz. Das würden sie mental nicht verkraften, sagt Dalit Ram Aharon, die zu diesen Familien gehört.
Die 45 Jahre alte Frau, mit der die F.A.Z. schon im Frühjahr gesprochen hatte, sagt auch, viele fühlten sich noch nicht bereit für eine Rückkehr. Der Krieg sei immer noch nicht zu Ende, und die Entführten seien nach wie vor in Gaza. Angesichts dessen, sagt Ram Aharon, sei es „sehr schwer, zu sehen, wie sie die Häuser abreißen und neue bauen“. Der Kibbuz werde nicht mehr derselbe sein wie zuvor. „Er wird etwas anderes sein. Auch wenn ich selbst noch nicht sagen kann, ob das gut ist oder schlecht.“