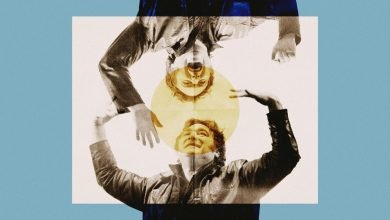Ausländische Agenten in Russland: Putins System frisst seine Kinder | ABC-Z

Jemand musste Sergej Markow verleumdet haben. Ohne Vorwarnung wurde der 67 Jahre alte Moskauer Politologe am 22. August zum „ausländischen Agenten“ erklärt. Der Status geht mit immer mehr staatlichen Schikanen einher, steht oft am Anfang einer Repressionskaskade, die Russland „vor Einflüssen von außen schützen“ solle, wie sein Präsident einmal sagte. Aber mit Markow ist nun ein prominenter Gefolgsmann Wladimir Putins ins Visier der Behörden geraten. Jemand, der selbst fordert, gegen „Feinde“ und „Verräter Russlands“ hart und härter vorzugehen. Und der sich jetzt vorkommt wie in einem Kafka-Roman.
Zum Treffen schlägt Markow ein Restaurant in einem schicken Einkaufszentrum an einer Ausfallstraße westlich der russischen Hauptstadt vor. Die Milliardärsmeile Rubljowka und die Hauptresidenz des Präsidenten sind nah, von den Läden prangen die Namen italienischer Modemarken, im Hof plätschert ein Brunnen, auf dem Parkplatz warten Chauffeure in dunklen Wagen. Von Markows Sakko, weiß mit blauen Streifen, prangt ein Modewappen. Er sagt, nur für Arbeitstreffen komme er her, privat nie.
Mit der Arbeit wird es jetzt schwieriger für Markow. Dabei kann er druckreif sprechen, ordnet Aktuelles aus Moskauer Sicht ein, findet einprägsame Bilder. Zum Beispiel, dass der amerikanische Präsident als New Yorker Immobilienunternehmer den Krieg in der Ukraine wie ein schlechtes Hotel sehe, das Verlust mache und das er irgendwelchen Idioten verkaufen wolle. Das Gespräch findet vor Donald Trump jüngsten Äußerungen statt, die wieder günstiger für Kiew und kritischer gegenüber Moskau sind.
Mit klaren Redemustern hat Markow Erfahrung
Aber für Markow sind solche Schwankungen im Verhältnis zweier Männer wie Trump und Putin schlicht unvermeidlich. Neben „traditionellen Werten“ verbinde die beiden, dass sie „harte Kerle“ seien. Solche seien mal große Freunde, mal gebe es Konflikte. „Das ist normal, die Umstände ändern sich.“ Im Grunde warte Trump bloß auf einen Anlass, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben, weil sie China den Zugang zu den Rohstoffen des Landes öffneten, sagt Markow. Kiew könne den Krieg nicht gewinnen. Sogar wenn Russland von einer erstarkten ukrainischen Armee bedrängt würde, „was heute wie Phantasterei wirkt“, werde Russland „einfach taktische Nuklearwaffen einsetzen“, sagt der Politologe und lacht auf: „Daher haben sie keinerlei Chancen.“
Unter Trump sei das Gefühl, recht zu haben, in Russlands Gesellschaft und Führung stark gewachsen; Putin werde jetzt „nicht weiter nachgeben“, sei Trump schon „kolossal“ entgegengekommen, indem er sich bereit erkläre, Odessa, Kiew und andere „russische Städte“ nicht einzunehmen. Das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum vor Kurzem schildert Markow in unterschiedlichen Varianten, die eint, dass Russland nicht für den Vorfall verantwortlich sei und davon nur Nachteile habe, dass es sich um eine ukrainische Intrige handele.
Mit solchen Redemustern hat Markow mehr als vierzig Jahre Erfahrung. Nach ein paar Jahren als Mechaniker in einem Rüstungswerk im Moskauer Umland und dem Wehrdienst lernte er in den Achtzigerjahren an der Philosophischen Fakultät der Moskauer Staatsuniversität im Zweig „wissenschaftlicher Kommunismus“, dessen unausweichlichen Sieg in dialektischen Volten zu begründen. Es kam anders.
Doch das Handwerk, die Kontakte und die ideologische Biegsamkeit blieben im neuen Russland Erfolgsfaktoren. Mehr denn je, als Putin sich anschickte, die Negation der Sowjetunion zu negieren, die Uhr zurückzudrehen. Markow drehte mit. Arbeitete er in den Neunzigerjahren für amerikanische Einrichtungen, lehnt er heute frühere Kollegen ab, die in den Westen entwichen sind. Wer „die Augen verschließt“ davor, dass in der Ukraine „2014 eine Junta die Demokratie liquidiert“ habe, sagt Markow etwa mit einem Kreml-Narrativ, „vernichtet sich weitgehend selbst“.
Ein Auftritt in Aserbaidschan hat Zorn hervorgerufen
Doch jetzt soll dieser Mann selbst auf der anderen Seite stehen. Zusammen mit zahlreichen anderen Politologen, Journalisten, Wahlbeobachtern, Schriftstellern, Menschenrechtsschützern, Oppositionspolitikern, Musikern, die vor ihm ins „Register“ der „Agenten“ des Justizministeriums aufgenommen wurden. Er, der als prorussischer Politologe in der Ukraine wirkte und Dauergast in russischen Medien war. Den Kanada und die Ukraine mit Sanktionen belegt haben. Der 2012, vor Putins Rückkehr ins Präsidentenamt, dessen „Vertrauensperson“ war und von 2007 bis 2011 für die Machtpartei Einiges Russland in der Duma saß. Kaum stand Markows Name auf der Liste der „Agenten“, entfernte ihn die Partei von ihrer Website, versteckte ihn wie einen Paria.
Offiziell begründete das Justizministerium seinen Schritt damit, dass Markow an „Materialien“ anderer „Agenten“ beteiligt gewesen sei, dass er ihre Mitteilungen sowie „unglaubwürdige Informationen“ über die Tätigkeit russischer Behörden verbreitet habe. Beispiele nannte es nicht. Längst lässt das Gesetz einen vagen „ausländischen Einfluss“ genügen, um jemanden zum „Agenten“ zu erklären, Geldflüsse verlangt es nicht mehr. Vonseiten der Mächtigen seien ihm keinerlei Vorwürfe gemacht worden, hebt Markow hervor.
Doch im Juli hatte ein Auftritt des Politologen bei einem Forum in Aserbaidschan in den sogenannten Z-Kanälen prorussischer Kriegsblogger Zorn hervorgerufen. In der Stadt Schuscha, welche die Truppen von Machthaber Ilham Alijew vor fünf Jahren armenischer Kontrolle entwanden, ehe sie vor zwei Jahren auch das übrige Nagornyj Karabach eroberten, rühmte Markow Alijew vor Kameras als „glänzenden Intellektuellen“, der ein „Siegerland“ verkörpere. Markow ist Aserbaidschan schon länger verbunden.
Doch jetzt liegen Moskau und Baku über Kreuz, streiten vordergründig über den russischen Beschuss eines aserbaidschanischen Passagierflugzeugs Ende Dezember, dem eine Notlandung in Kasachstan mit 38 Toten folgte, sowie über Festnahmen von Aseris in Russland und Russen in Aserbaidschan. Dahinter steht, dass Russlands Gewicht im Südkaukasus stark gesunken ist.
Die Kriegsblogger warfen Markow auch vor, „entzückt“ oder „schadenfroh“ zugeschaut zu haben, als eine Ukrainerin Alijew auf dem Forum eine Sammlung mit Abzeichen ukrainischer Militäreinheiten übergab. Ein Z-Blogger schrieb, Markow „hat sich in Russland als Politologe begraben“, ein anderer forderte, ihn als „Agenten“ einzustufen. Als es bald darauf dazu kam, rief der Staatsfernseheinpeitscher Wladimir Solowjow in neostalinistischer Rhetorik dazu auf, den „aserbaidschanischen Agenten“ ins Gefängnis zu werfen, „all diese Einflussagenten müssen endgültig ausgeschaltet werden“.
Markow muss seinen „Agentenstatus“ kenntlich machen
Ähnlich äußerte sich Markow bis vor Kurzem selbst. Als ein unabhängiger Statistiker Ende Mai zum 1000. „Agenten“ erklärt wurde, schrieb der Politologe auf seinem Hauptkanal bei Telegram, „Markows Logik“, westliche Politiker rieben sich die Hände, denn bei diesem Tempo werde das Justizministerium nicht so bald auch nur zehn Prozent aller „Agenten“ erreichen. Ende Dezember 2023 hatte Markow gefordert, den „Agenten“ Einkünfte und Publikum zu nehmen. So geschah es: Zum schon üppigen Verbotskatalog kamen 2024 Verbote hinzu, bei „Agenten“ Werbung zu schalten. „Agenten“ dürfen nicht mehr bei Wahlen kandidieren. Im Dezember wurde beschlossen, dass Einkünfte von „Agenten“ aus geistiger Tätigkeit, Immobilien und Ersparnissen automatisch auf Sonderkonten fließen müssen. Seit Kurzem dürfen „Agenten“ nicht mehr in der Ausbildung und in führenden Positionen in Staatsunternehmen tätig sein. Und schon länger nicht mehr im Staatsdienst.
Im Restaurant will Markow, jetzt „Agent“ Nummer 1053, nicht über Aserbaidschan reden, und auch nicht darüber, ob die eigene Betroffenheit seinen Blick auf die „Agenten“-Gesetzgebung geändert habe. Über den neuen Status wolle er erst sprechen, wenn er geklärt habe, warum er auf die Liste gekommen sei, sagt er. „Das Thema ausländischer Agenten“ werde sich in vielen europäischen Ländern entwickeln, die versuchten, „ihre souveräne Kontrolle zu verstärken“, hebt er hervor. Besonders wenn sich das Land in einer „harten Auseinandersetzung“ befinde, sei das „ein absolut objektiver Prozess“. Das klingt nach Verständnis für die Machthaber, nach Hoffnung auf einen Weg zurück.
Geklagt hat er noch nicht. „Ich bin schon lange im politischen Leben und kann sagen, dass es solche Fälle gibt“, sagt Markow, „oft hängen sie gar nicht von uns ab.“ Gleich nach seiner Einstufung als „Agent“ hatte Markow gegenüber russischen Journalisten von einem möglichen „Fehler“ gesprochen, wie sie eben vorkämen, auf Telegram dagegen „Feinde „Russlands“ für den Schritt verantwortlich gemacht, die sich als „Verräter“ erweisen oder als korrupt entlassen würden. „Ich bin und bleibe Patriot Russlands und ein Anhänger Wladimir Putins“, schrieb er da. Nach Solowjows Attacke lehnte Markow es ab, aus dem Land zu fliehen wie viele „Agenten“ vor ihm. „Man möchte an Russland glauben“, sagte er.
Jetzt spricht Markow von „vielen technischen Lebensmomenten“, die er auch erst einmal klären müsse. Seine Abonnentenzahl auf Telegram sei um zehn Prozent gesunken; nun folgen „Markows Logik“ gut 73.000 Profile. Um dreißig Prozent sei die Zahl der Aufrufe der Posts zurückgegangen. Die versieht Markow jetzt mit dem Hinweis in Großbuchstaben, dass er sie als „Agent“ verfasst habe. Täte er das nicht, drohten Bußgelder, für „böswillige“ Unterlassung gar Haft. Zitieren ihn russische Medien, müssen sie ihn als „Agenten“ ausweisen, meist geschieht das mit einem Sternchen hinter dem Namen und einer entsprechenden Fußnote. Noch immer riefen ihn viele Journalisten an, sagt der Politologe. „Aber ich sage ihnen: Wissen Sie, ich will Ihnen kein Problem bereiten, weil ich zum ‚ausländischen Agenten‘ erklärt worden bin.“ Das verständen die Leute und sagten ab.
Gehen Putins System die Gegner aus?
Als das Justizministerium an jenem Freitag – wenn die Namen neuer „Agenten“ typischerweise verkündet werden – auch seinen Namen bekannt gab, sei er „erschüttert“ gewesen, sagt Markow. „Aber nicht nur ich. Alle waren erstaunt.“ Markow sagt, dass er „als einziger Anhänger Putins“ zum „Agenten“ erklärt worden sei, „stresst natürlich sehr viele Anhänger Putins“, die sähen, dass sie dennoch „ein Problem bekommen können“, nicht geschützt seien. Er selbst sei sogar in der „schwierigsten Lage“ von allen „Agenten“, sagt Markow: Als „nicht prowestlicher Politiker“ erhalte er keine Unterstützung aus dem Westen.
Doch ein paar Tage nach dem Gespräch stellt sich heraus, dass Markow kein Einzelfall bleibt. Dass er womöglich ein Vorläufer ist, weil Putins System im eigenen Land die Gegner ausgehen und es sich gegen Loyalisten wendet, wie etwa die exilrussische Onlinezeitung „Moscow Times“ vermutet. Denn mit der Nummer 1076 setzt das Justizministerium Roman Aljochin auf seine Liste der „Agenten“.
Der 45 Jahre alte Geschäftsmann aus dem westrussischen Kursk, ein früherer Polizist und Händler mit Prothesen, fand im Krieg ein großes Publikum als Z-Blogger, besonders als die ukrainische Armee in sein Heimatgebiet einfiel. Aljochin beriet Putins Mann für das Kursker Gouverneursamt, Alexej Smirnow, der entsprechende Scheinwahlen im September 2024 gewann, aber bald darauf zurücktrat und im April unter Korruptionsvorwürfen festgenommen wurde.
Smirnow soll jüngst zugegeben haben, Schmiergeld, nach heutigem Kurs umgerechnet gut 300.000 Euro, für den unter Mängeln vorgenommenen Bau von Befestigungsanlagen im Kursker Gebiet angenommen zu haben. Wohl wegen ähnlicher Vorwürfe hatte Putin Anfang Juli Smirnows Vorgänger im Gouverneursamt, Roman Starowojt, als Verkehrsminister entlassen, der sich gleich darauf erschossen haben soll.
„Jeder weiß, dass Markow ein ehrlicher Mensch ist“
Womöglich stoßen sich die Mächtigen daran, dass Aljochin, wie andere Z-Blogger, auch Kritik an der Führung des Militärs äußert, dieses dabei wegen der Zensur bisweilen als „Armee von Laos“ bezeichnet. Zugleich werden ihm Vorwürfe gemacht, sich über einen eigenen Hilfsfonds an Spenden für Frontsoldaten zu bereichern. Vor Kurzem verbreiteten mehrere Telegram-Kanäle ein mit versteckter Kamera aufgenommenes Video, in dem der Blogger erläutert, wie man solche Gelder abzweigen könne.
Eine Parallele zum Fall Markow besteht darin, dass auch Aljochin schon Ziel der Tiraden des Staatsfernsehmanns Solowjow geworden ist, dem seine eigenen Luxusimmobilien in Italien bisher nicht vom Justizministerium als Quell „ausländischen Einflusses“ vorgehalten worden sind und der mit einer eigenen Stiftung selbst Spenden für die Front sammelt. „Aljochin ist nicht einfach ein Dieb, er ist ein Vaterlandsverräter“, eiferte Solowjow. „Ihr anderen – wartet ab, sie werden zu allen kommen.“ Wie Markow reagierte auch Aljochin, indem er selbst auf Verräter wies, und beteuerte auf Telegram. „Die Heimat, das russische Volk und Gott werde ich nicht verraten.“
Im Restaurant nahe der Präsidentenresidenz erwartet der Politologe Markow für Russlands Zukunft, dass politisch zwar „alle auf ihren Plätzen bleiben“, sich aber der „Kampf gegen Korruption“ verschärfe. Das wolle die Bevölkerung, und im Rüstungssektor werde viel Geld abgezweigt, dort sei mehr Kontrolle unvermeidlich. Sich selbst sieht Markow aber gewappnet. „In der Vergangenheit sind praktisch alle meine Gegner wegen Korruption aus ihren Ämtern entfernt worden“, sagt er. „Jeder weiß, dass Markow ein ehrlicher Mensch ist.“