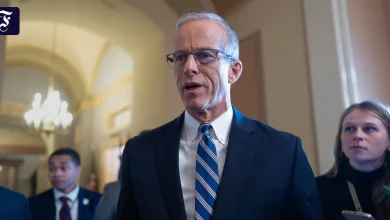Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz: Der Tod ist radikal genug | ABC-Z

Die Ampelkoalition in Mainz stand stets im Schatten ihres Berliner Pendants. Aber wenn man Politik aus gegebenem Anlass einmal unter dem Blickwinkel der Ewigkeit betrachtet, dürfte das neue Bestattungsgesetz, das der Landtag in Rheinland-Pfalz mit den Stimmen der Regierungsparteien und der AfD beschlossen hat, alle gesellschaftspolitischen Reformen der Regierung Scholz in den Schatten stellen. Es hebt die grundsätzliche Verpflichtung, Verstorbene in einem Sarg und auf einem Friedhof zu begraben, auf. Kein anderes Bundesland ist bisher so weit gegangen.
Noch vor nicht allzu langer Zeit wäre es kaum vorstellbar gewesen, dass Angehörige oder Freunde die Asche von Toten in einer Urne zu Hause aufbewahren dürfen, wenn die Verstorbenen diesen Wunsch schriftlich festgehalten haben. Und eine Urnenbestattung in Flüssen wünschten sich allenfalls Kapitäne.
Nur noch eine Minderheit glaubt an die Auferstehung
Die Reform markiert den vorläufigen Höhepunkt einer Entwicklung, die unaufhaltsam voranschreitet: Der Tod verschwindet mehr und mehr aus dem öffentlichen Leben. Das lässt sich auf Friedhöfen besichtigen. Grabplätze bleiben reihenweise frei, weil die Verstorbenen in Sammelgräbern, Kolumbarien oder Friedwäldern beigesetzt werden. Gern bemühen Befürworter daher das Standardargument für derartige Reformen: Die Gesetzesreform kodifiziere lediglich das, was gesellschaftlich ohnehin längst akzeptiert sei. Der Umgang mit Verstorbenen sei eben zur Privatsache geworden, und der Wunsch nach Anonymität habe zugenommen.
Aber so einfach ist die Sache dann doch nicht. Das Bestattungsgesetz wirft grundsätzliche Fragen auf, etwa die nach dem Umgang mit christlichen Traditionen. Die Friedhofspflicht in ihrer heutigen Form ist in erster Linie aus hygienischen Gründen entstanden. Aber der Ursprung des heutigen Bestattungswesens ist religiöser Natur. Ohne den christlichen Glauben an eine leibliche Auferstehung der Toten ist es nicht erklärbar.
Das wörtliche Verständnis der leiblichen Auferstehung ist theologisch längst überholt. Dass dafür die Bestattung des Leichnams in einem Sarg auf einem Friedhof zwingend nötig sei, behauptet heute selbst die katholische Kirche nicht mehr. Den Glauben daran hat das nicht gerettet. Eine Mehrheit der Gesellschaft kann mit der Vorstellung einer Auferstehung der Toten nicht mehr viel anfangen, selbst unter den Mitgliedern der beiden großen Kirchen hadern nicht wenige damit.
Ein Diamant kann mehr Trost spenden als ein Besuch am Grab
Der religiöse Grund für eine Erdbestattung des Leichnams ist somit für einen großen Teil der Bevölkerung entfallen. Da auch die hygienischen Gründe für die Friedhofspflicht seit dem Aufkommen der Krematorien weitgehend gegenstandslos geworden sind, stellt sich die Frage: Wie lässt sich die Friedhofspflicht dann noch begründen? Schließlich stellt sie einen schwerwiegenden staatlichen Eingriff dar.
Man kann den Untergang der Friedhofskultur beklagen. Die öffentliche Trauer um Verstorbene kann großen Trost spenden. Ein Grabstein oder ein Kreuz, auf dem Name und Lebensdaten verzeichnet sind, hält die Erinnerung an einen Toten wach. Und die Vorstellung, die Asche eines Verstorbenen zu einem Diamanten zu verarbeiten, den der Ehepartner am Ring trägt, kann man durchaus befremdlich finden. Allerdings sollte man auch davor die Augen nicht verschließen: Einer wachsenden Zahl von Bürgern spendet diese Form des Totengedenkens offenbar mehr Trost als ein Besuch am Grab. Wer wollte sich da zum Richter aufschwingen?
Schwer bestreiten lässt sich auch, dass eine Urne im Wohnzimmer ein würdigeres Totengedenken darstellen kann als ein völlig verwahrlostes Grab auf dem Friedhof. Auch bei großen Sympathien für die traditionelle Bestattungskultur kommt man nicht um die Einsicht herum: Keine Gesetzgebung kann verhindern, dass sie womöglich zum Auslaufmodell wird. Das ist auch nicht Aufgabe des Staates.
Aber es bleibt ein Unbehagen. Der Vorwurf der CDU-Opposition, die Landesregierung mache sich damit zum „Totengräber der Friedhöfe“, geht nicht völlig ins Leere. Aufhalten kann der Staat den Traditionsverlust im Umgang mit den Toten auf Dauer zwar nicht. Zu dessen Schrittmacher und Beschleuniger sollte er sich jedoch keineswegs machen.
Diese Befürchtung erscheint im Fall von Rheinland-Pfalz nicht ganz unberechtigt. Denn es ist schon verwunderlich: Ausgerechnet dieses vergleichsweise beschauliche Bundesland prescht bei der Bestattungsgesetzgebung vor. Es sollte zu denken geben, dass die ostdeutschen Bundesländer, in denen die Säkularisierung noch viel weiter fortgeschritten ist, restriktivere Bestattungsgesetze haben. Wenn es um die Gesetzgebung für den Umgang mit Toten geht, sind Besonnenheit und Zurückhaltung besonders nötig. Der Tod ist schon radikal genug.