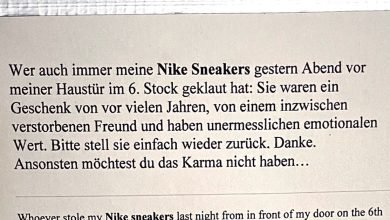Lausitzer Seenland: Flutungszentrale ändert ihr Aufgabengebiet – und bekommt neuen Namen | ABC-Z

Wassermanagement
–
Lausitzer Flutungszentrale ändert ihr Aufgabengebiet – und den Namen
Mo 22.09.25 | 16:14 Uhr | Von
Damit alte Lausitzer Tagebaulöcher keine Grundwassertümpel bleiben, gibt es seit 25 Jahren die Flutungszentrale. Sie steuert den Wasserzufluss – und nun auf neue Aufgaben zu. Von I. Wussmann und M. Schneider
6,4 Milliarden Kubikmeter Wasser, diese riesige Menge ist in den letzten Jahrzehnten in der Lausitz in die Restlöcher und das Grundwasser geleitet worden, nachdem die Kohlebagger weg waren. Inzwischen haben die meisten Tagebauseen ihren Zielwasserstand erreicht – deshalb ändert die Flutungszentrale des Bergbausanierers LMBV in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) ihr Aufgabengebiet. Das hat die LMBV am Montag zur der 25-Jahr-Feier der Zentrale mitgeteilt [lmbv.de].

Hintergrund ist, dass die Kernaufgabe immer mehr in der Bewirtschaftung der Bergbaufolgeseen und der Flussgebiete im Lausitzer Revier liege, heißt es. Deshalb werde die Flutungszentrale in “Wasserbewirtschaftungszentrale Lausitzer Revier (WBLR)” umbenannt.
Wasserhaushalt reguliert sich nicht selbst
“Wir müssen erkennen, dass die Seen künstliche Gewässer sind, die keinen direkten Zulauf haben”, sagte der technische Geschäftsführer der LMBV, Bernd Sablotny, dem rbb. Das Wasser werde über Zuläufe und Abläufe gesteuert. Laut Sablotny ist die Steuerung der Menge und Wasserqualität eine dauerhafte Aufgabe. “Einen selbstregulierenden Wasserhaushalt werden wir hier in der Lausitz nicht bekommen.”
Aufgaben verschieben sich
Seit der Gründung im September 2000 hat die Flutungszentrale vor allem dafür gesorgt, dass die ehemaligen Tagebaulöcher koordiniert volllaufen. “Am Anfang war das Ziel, dass wir wirklich nur das Wasser in die Seen bekommen”, sagte die langjährige Mitarbeiterin Anne-Kathrin Dydymski dem rbb. “Dann kam dazu, dass wir das auch in einer ordentlichen Qualität haben wollen – nicht, dass jemand mit Badeanzug reingeht und ohne wieder rauskommt.”
Das saure Wasser in den Gruben wird mit Flusswasser aus Spree, Neiße und Schwarzer Elster verdünnt. Allerdings darf nur so viel entnommen werden, wie die Flüsse problemlos abgeben können. Mit Kalk wird der pH-Wert angehoben. Immer mehr haben sich die Aufgaben in letzter Zeit in Richtung Managen des Wasserhaushaltes verschoben.
Flüsse vor dem Austrocknen bewahren
Umgekehrt können wiederum die Bergbaufolgeseen in trockenen Sommermonaten auch den Flüssen und ihnen Wasser zur Verfügung stellen, so der Chef neuen Wasserbewirtschaftungszentrale Lausitzer Revier, Maik Ulrich.
Mit dem überschüssigen Wasser in den Bergbaufolgeseen können Flüsse wie die Schwarze Elster vor dem Austrocknen bewahrt werden. Anhand vieler Messstellen wird das von der Bewirtschaftungszentrale in Senftenberg aus über Wehre und Überleitungskanäle gesteuert und überwacht. Das ist Teil der Daueraufgabe.
Über eine Million Messwerte
Die bisherige Flutungszentrale hat laut LMBV aktuell fünf Mitarbeiter. Sie werden täglich mit über eine Million Messwerte von ca. 4.400 Messstellen der wasserwirtschaftlichen Anlagen versorgt, heißt es. In der Zentrale werden 18 Ein- und zwölf Auslaufbauwerke, 47 Pumpstationen, 65 Wehranlagen und 13 Überleitungskanäle gesteuert und überwacht.
Für die Mitarbeiter komme nun eine neue Aufgabe hinzu. Die Anforderungen würden durch den Klimawandel steigen, der sich immer stärker zeige, so die LMBV. Hinzu kämen der geplante Kohleausstieg bis spätestens 2038 sowie eine enge Vernetzung mit den staatlichen Bewirtschaftern der Bundesländer, dem Landesamt für Umwelt (LfU) und der Landestalsperrenverwaltung (LTV).
Wegen all dieser Punkte müsse die Software für die Wasserbewirtschaftung innerhalb der LMBV komplett neu aufgestellt werden. Eine Standardsoftware gebe es nicht, es brauche “umfangreiche Anpassungen und Neuentwicklungen”.
Sendung: Antenne Brandenburg, 22.09.2025, 15:42 Uhr