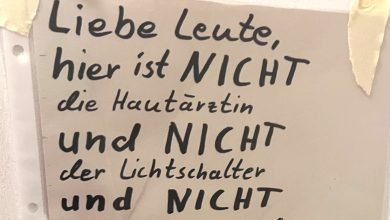Warum in Brandenburg keine elektronische Fußfessel eingesetzt wird | ABC-Z

Häusliche Gewalt
–
Warum in Brandenburg keine elektronische Fußfessel eingesetzt wird
Di 16.09.25 | 19:43 Uhr | Von
In Brandenburg kann mutmaßlichen Gewalt- und Sexualstraftätern zwar präventiv eine elektronische Fußfessel angelegt werden. Allerdings wurde davon bislang noch kein einziges Mal Gebrauch gemacht – trotz steigender Zahlen häuslicher Gewalt. Von Christoph Hölscher
- Elektronische Fußfessel gegen häusliche Gewalt seit 2024 möglich
- Bislang keine Anwendung dieses Mittels
- Polizeipräsidium verweist auf hohe rechtliche Hürden
- Gewerkschaft und Wissenschaftler fordern Nachbesserungen
Die gesetzliche Einführung der “elektronischen Aufenthaltsüberwachung (Fußfessel)” im Februar 2024 in Brandenburg lobte der damalige Innenminister Michael Stübgen (CDU) als “wichtigen Meilenstein im Kampf gegen häusliche Gewalt” gelobt. erhalte die Polizei “endlich umfassende Möglichkeiten, um potentielle Opfer zu schützen und Täter effektiv daran zu hindern, weitere Straftaten zu begehen”, so Stübgen damals.
Elektronische Fußfesseln sind GPS-Sender, die am Fußgelenk getragen werden und nicht abgelegt werden können. Missachtet der – meist männliche – Träger eine festgelegte Verbotszone, etwa um den Wohnort oder Arbeitsplatz des mutmaßlichen – meist weiblichen – Opfers, wird ein Alarm ausgelöst. Das passiert auch, wenn er versucht, die Fußfessel zu entfernen.
Allerdings ist die Technik in dieser Form noch kein einziges Mal angewandt worden, wie das Polizeipräsidium in Potsdam vergangene Woche auf Anfrage der “Märkischen Allgemeinen Zeitung” einräumte. Gründe wollte man zunächst nicht nennen, aber mangelnder Bedarf kann es kaum gewesen sein: Im Jahr 2024 wurden in Brandenburg 6.790 Fälle häuslicher Gewalt gezählt, ein Anstieg von mehr als sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Polizeipräsidium verweist auf “hohe Hürden”
Auf Nachfrage von rbb|24 verweist Beate Kardels, Sprecherin der Polizeipräsidiums Potsdam, auf die “hohen Hürden” beim präventiven Einsatz der elektronischen Fußfessel. Der Täter werde dadurch ja “de facto elektronisch überwacht” – und zwar präventiv, ohne dass er bereits eine Straftat begangen habe. Bevor das gesetzlich möglich sei, müssten zunächst viele andere Mittel ausgeschöpft werden, erläutert Kardels. Wenn die Polizei feststelle, dass es “eine ganz konkrete Gefahr für eine Person” gebe, könne sie etwa einen präventiven polizeilichen Gewahrsam anordnen.
Die elektronische Fußfessel sieht Kardes lediglich als “zusätzliches Mittel”: “Wir haben es und das ist auch gut so. Und wenn wir es brauchen, können wir auch darauf zurückgreifen.” Bisher war das in Brandenburg nicht der Fall – zumindest nicht bei der Polizei und als Prävention gegen häusliche Gewalt. Die elektronische Fußfessel wurde hierzulande bislang nur in zwei Fällen auf Grundlage des Strafgesetzbuches angewandt. Dabei ordnen Richter dieses Mittel für verurteilte Sexualstraftäter an.
Gewerkschaft fordert “spanisches Modell”
Anita Kirsten, Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), hält die elektronische Fußfessel für einen “guten Ansatz” zur Bekämpfung häuslicher Gewalt. Allerdings bezweifelt sie, dass sie in der in Brandenburg möglichen Form wirklich gut funktionieren würde. So sei der Weg der Meldung im Ernstfall – also, wenn sich ein mutmaßlicher Täter dem Opfer nähert – “viel, viel zu lang”. Da die Technik für ganz Deutschland aus Hessen komme und auch dort überwacht werde, dauere es bis zu einer halben Stunde, bis die Polizei auch tatsächlich am Ort des Geschehens sein könne.
Außerdem sei die Überwachung beim möglichen Einsatz in Brandenburg auf einzelne Verbotszonen beschränkt, wie etwa die Wohnung oder die Arbeitsstätte des potenziellen Opfers, sagt Kirsten. Das schließe aber nicht aus, dass Opfer und Täter sich auch an einem völlig anderen Orten begegnen könnten. Die GdP fordert deshalb den Einsatz des “spanischen Modells”: In Spanien trage das mögliche Opfer einen GPS-Tracker, quasi einen Empfänger für die Fußfessel des mutmaßlichen Täters. Wenn dieser sich nähere, werde das Opfer alarmiert und könne sich in Sicherheit bringen, so Kirsten. Gleichzeitig gehe auch eine Meldung bei der Polizei mit ein.
Das Innenministerium in Potsdam erklärte auf Anfrage von rbb|24, dass dort gerade geprüft werde, ob diese Anwendung auch in Brandenburg erforderlich sei und umgesetzt werden könne.
Kriminologe: Wissenschaftliche Begleitung erforderlich
Der Kriminologe Thomas Feltes von der Ruhr-Universität Bochum ist skeptisch, ob solch eine Anpassung genügt. Es gebe keine rein “technologische Lösung” für das Problem häusliche Gewalt. Beim Einsatz der elektronischen Fußfessel komme es vor allem auf die begleitenden Maßnahmen an, etwa die Betreuung und Beratung der betroffenen Frauen. Das sei nach seiner Überzeugung auch beim “spanischen Modell” der Fall, sagt Feltes. So bestehe dabei zum Beispiel die Gefahr, dass ein Fehlalarm die Frau “unnötig in Angst versetzen” könne oder der Täter sie gar durch “gezieltes Auslösen des Alarms” bedrohe.
Eine “engmaschige Betreuung” der Frau wäre nötig, um sie auf solche und andere Situationen vorzubereiten. Das erfordere großen Aufwand und koste viel Geld. In Spanien gebe es dafür eine “über Jahre gewachsene personelle und technologische Infrastruktur”, so der Kriminologe. Bevor diese nicht auch in Deutschland existiere, könne man die Technologie hierzulande kaum erfolgreich und im größeren Stile einsetzen. Er wünsche sich daher ein wissenschaftlich begleitetes “Pilotprojekt”, das diese und andere Fragen klären sollte.
Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 16.09.2025, 19:30 Uhr