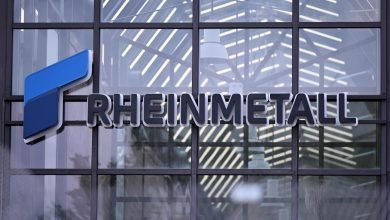Psychiater Andreas Reif: Wie verhindert man Amoktaten? | ABC-Z

Herr Reif, die hessische Landesregierung will das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz novellieren. Demnach sollen künftig Ärzte die Sicherheitsbehörden informieren, wenn sie der Meinung sind, dass von einem Patienten eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehen kann. Unter Psychiatern ist das Vorhaben umstritten. Warum?
Weil die aktuelle Formulierung des Gesetzesentwurfs sehr breit angelegt ist. Es sollten Einzelfälle erfasst werden, also Patienten, bei denen der Arzt wirklich große Sorge hat, dass der Patient gleich nach der Entlassung aus der Klinik eine Gewalttat begeht. Das ist so weit auch nachvollziehbar, wenn man das als Beitrag zur Gefahrenabwehr, also zum Schutz der Bevölkerung, sieht. So, wie das Gesetz aber derzeit formuliert ist, geht es nicht um Einzelfälle.
Sondern es ist sehr schwammig formuliert, sodass der Eindruck entsteht, der Staat wolle massenhaft Daten über Menschen mit psychischen Erkrankungen sammeln, was dann natürlich auch Auswirkungen auf die ärztliche Schweigepflicht und das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten hat. Das ist problematisch.
Dennoch gehören Sie zu den führenden Psychiatern, die einer solchen Gesetzesänderung nicht gänzlich abgeneigt sind.
Das ist richtig. Immerhin hatten wir ja in jüngster Vergangenheit einige Gewalttaten, die durch psychisch Kranke begangen worden sind. Und in einigen Fällen waren die Täter kurz zuvor noch in der Psychiatrie und sind dann aus unterschiedlichen Gründen entlassen worden. Darauf muss man Antworten finden, auch wenn es sich hier nur um sehr wenige Menschen handelt.
Aber auch da bleibt der Gesetzesentwurf zu vage. Nehmen wir an, ein Patient, von dem mit hoher Wahrscheinlichkeit eine hohe Fremdgefährdung ausgeht, wird an die Sicherheitsbehörden gemeldet. Was passiert dann? Eine Meldung allein verhindert noch keine Gewalttat. Es muss also entsprechende weitere Schritte geben.
Wie könnten die aussehen?
Bestimmt nur in einigen Fällen in Form von Gefährderansprachen, wie es die Polizei bei Personen vollzieht, die ganz geplant und überlegt oder aus ideologischen Motiven eine Straftat vorbereiten. Denn Menschen mit einer psychischen Krankheit, von denen wir hier sprechen – wie akute Psychosen –, handeln nicht rational. Sie sind für diese Art von Ansprachen nicht empfänglich. Auch die reine Überwachung wird nichts bringen.
Denn wie soll das personell überhaupt geleistet werden? Letztlich ist die effektivste Verhinderung von Gewalttaten im Kontext psychischer Erkrankungen eine gute Behandlung und Therapie. Da stellt sich eher das Problem, dass man diejenigen, die man intensiver behandeln müsste, gar nicht in die entsprechenden Therapien bekommt.
Können Sie das näher ausführen?
Es gibt schon jetzt Gesetzesgrundlagen, die eine Meldung von Patienten erlauben. So müssen wir die Patientengruppen, um die es hier geht, ohnehin an den Sozialpsychiatrischen Dienst der Gesundheitsämter melden. Darüber hinaus steht es jedem Kollegen frei, dass über andere juristische Grundlagen der akuten Gefahrenabwehr eine Meldung erfolgt. Wir haben also schon gesetzliche Hebel, die nur angewendet werden müssen. Das Problem ist vielmehr, die Menschen tatsächlich in diese Hilfen zu bringen.
Wir können in der Psychiatrie sagen, das sind Patienten, von denen eine latente Gefahr ausgeht. Aber wie? Und in welchen Zeitrahmen? Das wissen wir nicht. Da spielt auch der Konsum von Substanzen eine Rolle, die die Einschätzung noch viel unvorhersehbarer machen. Denn viele solcher Straftaten werden im intoxikierten Zustand begangen. Eine Vorhersage zu treffen, wie gefährlich sich ein Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt entwickelt, ist so schwer wie die Vorhersage beim Wetter.
Ich würde gerne noch einmal auf den Punkt zurückkommen, der den Prozess nach dem Meldevorgang betrifft. Sie haben ja in der Anhörung im Landtag Vorschläge gemacht, wie das Gesetz Ihrer Ansicht nach ausgestaltet werden müsste. Wie sähe dieser Schritt aus?
Im Prinzip müsste man solchen Patienten ein sehr intensives Behandlungsangebot machen. Man müsste ihnen deutlich machen: Wir haben dich im Blick, aber wenn du dich jetzt in Behandlung begibst, hast du die Chance, gesund zu werden und dann auch nicht mehr gewalttätig und damit straffällig zu werden.
Würde das so einfach funktionieren?
Bei den Patienten mit schizophrenen Psychosen oder auch mit Abhängigkeitserkrankungen, wobei häufig beides zusammenkommt, wird das natürlich schwer. Aber auch bei denen wäre das ein Ansatz. Das sind in der Regel keine Patienten, die ein einziges Mal irgendetwas gemacht haben, dann wegen einer Fremdgefährdung in die Psychiatrie kommen und ansonsten lammfromm ihr Leben leben.
Das sind häufig schon Menschen, bei denen es immer wieder zu Gesetzesverstößen kommt und dann auch zu Konflikten mit der Polizei. Wenn jemand also immer wieder auffällig wird, müssen wir uns fragen, ob wir die Schwelle niedriger setzen. Das Abwägen zwischen Sicherheit und Freiheit erfordert aber eine gesellschaftlich-politische Diskussion.
Dass wir diese Menschen dann gegebenenfalls gegen ihren Willen in eine Klinik bringen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, diese Patientengruppe einer Behandlung zuzuführen. Diesen Personen wird ja auch durch polizeiliche Überwachung oder durch einen Aufenthalt im Gefängnis nicht geholfen. Die brauchen Therapie. Denn wenn sie handeln, dann aus dem Affekt heraus, aus akuten Gefühlszuständen.
Sie können sich dann selbst nicht steuern. Wenn Sie dem Patienten heute sagen: „Benimm dich“, dann klappt das vielleicht eine Stunde. Aber am nächsten Tag sieht es schon wieder anders aus. Dieser Patientengruppe deshalb niedrigschwellig eine Behandlung anzubieten, das wäre eigentlich das Ziel.
Aber woran liegt es, dass das bisher nicht gelingt?
Da muss ich etwas ausholen. Denn da sieht es wirklich düster aus. Wir haben natürlich diese Patientengruppe bei uns in den Kliniken, etwa nach Gewalttaten, wo wir aus ärztlicher Sicht der Meinung sind, diese Patienten müssten wirklich einmal ein Jahr lang konsequent in einer Einrichtung des Maßregelvollzugs oder einer forensischen Einrichtung stringent behandelt werden und dass die rechtlichen Grundlagen hierfür auch erfüllt sind. Und dann unter Behandlungsauflagen entlassen werden. Aber: Das passiert ja jetzt schon nicht.
Als Erklärung ist oft zu hören, dass einige Frankfurter Richter Klinikaufenthalte für Personen, die eine Gefahr für andere darstellen, nicht verlängern. Ist das ein Fehler im System?
Für Frankfurt gesprochen, ja. Ich möchte hier aber nicht alle Richter über einen Kamm scheren. Es gibt sehr viele, die sich intensiv mit einem Patienten und dessen Situation auseinandersetzen. Aber eben auch die, die nicht einmal mit uns sprechen. Die offenbar grundsätzlich der Meinung zu sein scheinen, dass niemand eine Therapie gegen seinen Willen benötige, auch, wenn eine weitere Fremdgefährdung höchstwahrscheinlich ist.
Es gab einmal einen Fall, da hat jemand gesagt: Wenn ich jetzt rauskomme, dann bringe ich meine Mutter um. Das hat den Richter aber nicht gestört. Und dann kommt so etwas dabei heraus wie die Fälle, in denen tatsächlich jemand durch einen Angriff verletzt oder getötet wird, kurz nachdem der Täter aus der Psychiatrie entlassen worden ist.
Wie gehen Sie mit solchen Fällen um?
Wir haben schon mehrfach Dienstaufsichtsbeschwerden gestellt. Aber auch damit kommen wir nicht weiter, denn letztlich obliegen diese Entscheidungen – aus guten Gründen – der richterlichen Unabhängigkeit. Ebenso versuchen wir, gewalttätige Patienten auch immer wieder im Maßregelvollzug unterzubringen, aber das ist genauso schwer. Wir dokumentieren schon konsequent, wenn Straftaten in den Kliniken begangen werden. Wenn Patienten Körperverletzung, Brandstiftung oder Sachbeschädigung begehen.
Nicht weil wir dem Patienten schaden wollen, sondern weil wir wissen, dass das der einzige Weg ist, die Patienten einer Behandlung zuzuführen. Aber auch dieser Weg klappt so gut wie nie. Dabei gab es in den Kliniken schon schwerste Gewaltdelikte. Und dann muss man sich auch von Richtern anhören, dass man damit eben rechnen müsse, wenn man in einer Psychiatrie arbeite. Das finde ich zynisch.
Von Seiten der Sicherheitsbehörden kommt ja immer wieder auch der Vorstoß, in gemeinsamen Fallkonferenzen gemeinsam mit Psychiatern zusammenzuarbeiten, um sich ein Bild davon zu machen, wie gefährlich eine Person tatsächlich ist. Wäre das ein Modell, das Sie sich vorstellen könnten?
Unter bestimmten Bedingungen, ja. In Nordrhein-Westfalen gibt es ja zum Beispiel das Projekt „Periskop“. Generell gilt, dass solche Kooperationen so strukturiert sein müssen, dass sie einzelfallbezogen sind. Und: Es muss die Hilfe im Mittelpunkt stehen, nicht die reine Unterbringung oder Beobachtung. Es geht nicht um Verfolgung, sondern darum, die Menschen in Hilfsangebote und Therapien zu bringen. Das ist bei psychisch kranken Menschen mit Fremdgefährdung die effektivste Gefahrenabwehr.
Sie haben erwähnt, dass viele psychisch Kranke, die mit Gewalttaten auffallen, Drogenkonsumenten sind. Welche Rolle spielt Crack?
Eine große. Und die Tatsache, dass wir hier in Frankfurt diese riesige Crack-Szene haben, macht die Sache nicht besser. Das zeigt, wie stark belastet wir in Frankfurt sind. In anderen deutschen Städten ist die Situation zwar ähnlich, aber dort funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besser. Die Probleme, die wir im Bahnhofsviertel haben, übertragen sich eins zu eins in die Psychiatrien. Wir baden dort aus, was im Bahnhofsviertel schiefläuft.
Die Drogenpolitik muss stärker medizinisch angegangen werden und nicht nur sozialpolitisch. Da haben wir in Frankfurt ein großes Ungleichgewicht. Dann wäre es auch möglich, das Bahnhofsviertel und somit die gesamte Stadt stärker zu entlasten. Derzeit passiert das nicht. Aber genau an dieser Stelle brauchen wir eine Wende.