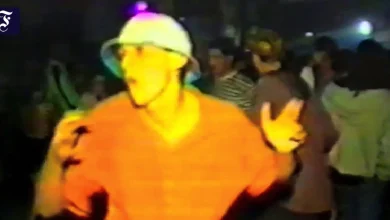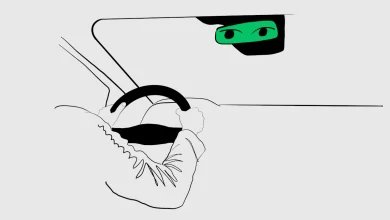Von Hartz IV. bis Riester Rente: Diese Politiker haben die deutsche Wirtschaft reformiert | ABC-Z

Angst vor Arbeitslosigkeit“, „Die Industrie wandert ab“, „Jedes Jahr fehlen 30 Milliarden“: Was klingt wie die Schlagzeilen von heute, sind solche aus den Jahren um die Jahrtausendwende. Damals galt Deutschland als der „kranke Mann Europas“, der dringend umfassende wirtschaftliche Reformen benötigte. Zwar gibt es bislang „nur“ drei Millionen Euro Arbeitslose und nicht wie damals mehr als fünf Millionen. Doch Ökonomen sind sich einig, dass die wirtschaftliche Lage ähnlich gravierend ist wie vor zwanzig Jahren. In der Haushaltsplanung bis 2029 klafft trotz Rekordschulden eine 170-Milliarden-Euro-Lücke, die Sozialabgaben steigen immer weiter und machen zusammen mit hohen Steuern und überbordender Bürokratie den Standort Deutschland unattraktiv. Die Industrie fährt ihre Produktion in Deutschland herunter. 150.000 meist gut bezahlte Arbeitsplätze hat die volkswirtschaftlich so wichtige Branche binnen eines Jahres gestrichen.
Die Debatte über Auswege aus dem dritten wachstumslosen Jahr in Folge läuft auf Hochtouren. Mancher fühlt sich an die Situation zu Beginn des Jahres 2003 erinnert, kurz bevor Gerhard Schröder seine berühmt-berüchtigte Rede zur „Agenda 2010“ im Bundestag hielt. Ausgerechnet er, der SPD-Kanzler, leitete damals Reformen ein, die Sozialleistungen beschnitten (Hartz IV) und den Kündigungsschutz im Sinne der Unternehmen lockerten. Sie brachten Deutschland zurück auf den Wachstumspfad, leiteten letztlich aber auch das Ende von Schröders politischer Karriere ein.
Schröder wurde zur Leitfigur für alle, die auf die Einsicht und Entschlossenheit von Politikern setzen, zum Wohle des Landes auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Dass Schröder vorher lange für das Gegenteil stand, wird dabei gern ausgeblendet. Der ökonomische Erfolg seines politischen Tuns adelt gleichsam seine Zeit im Kanzleramt. Dass er selbst sein politisches Werk mit seinem Eintreten für Russlands Aggressor Wladimir Putin eingerissen hat, steht auf einem anderen Blatt.
Müntefering machte Tempo bei Anhebung des Rentenalters auf 67
Das Beispiel von Schröder zeigt, wie wichtig ein einzelner Politiker für schmerzhafte, aber zugleich notwendige Änderungen sein kann. Seine Nachfolgerin im Kanzleramt, Angela Merkel (CDU), beschreibt in ihrer Autobiographie die Geschichte eines anderen mutigen Sozialdemokraten: Franz Müntefering. Er überholte Merkel gewissermaßen von rechts, als er die von der Kanzlerin für das Jahr 2007 angekündigte schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre schon ein Jahr früher als geplant ins Kabinett einbrachte und den Zeitplan noch etwas nachschärfte. „Ich denke, dass Franz Müntefering bei diesem Thema schnell Nägel mit Köpfen machen wollte“, erinnert sich Merkel in ihrem Buch. „Er kannte seine Pappenheimer.“ Die Wucht der Ablehnung habe Müntefering aber wohl dennoch unterschätzt.
Damit setzte ausgerechnet ein SPD-Mann die CDU-Politikerin unter Zugzwang, die zu Oppositionszeiten noch als das personifizierte Reformversprechen galt. In ihrer Regierungszeit blieb von dieser Zuschreibung wenig übrig. Merkel erntete die Früchte der Agenda 2010. Ein ehrgeiziger Parteifreund namens Friedrich Merz kehrte frustriert der Politik den Rücken. Mit Deutschland ging es, unterbrochen durch den Dämpfer der Finanzkrise, wirtschaftlich wieder bergauf. In den Jahren 2015 bis 2019 verzeichnete der Bund sogar Haushaltsüberschüsse – die neuen Spielräume wurden freilich nicht für die Infrastruktur, die Digitalisierung oder die Bundeswehr genutzt, sondern wählerfreundlich für Soziales.
Reform-Politiker sind getrieben
Die Vergangenheit lehrt: Es kann noch so viele Ratschläge von Kommissionen, Beratergremien und Beiräten geben – ohne mutige Politiker, die sie sich zu eigenen machen, sind sie wenig wert. Oft sind die handelnden Personen dabei Getriebene. Schröder ging erst in die Reformoffensive, als es anders nicht mehr ging. Auch Hans Eichel, Ulla Schmidt, Wolfgang Clement und Walter Riester handelten in einer Mischung aus Einsicht und Zwang. CSU-Chef Markus Söder beschrieb vor wenigen Tagen das Dilemma der Parteivorsitzenden von Union und SPD anschaulich: „Wir vier sind nicht das Problem. Wir müssen unsere Parteien mitnehmen.“
Die SPD litt zwei Jahrzehnte unter den mit der Agenda 2010 verbundenen sozialen Härten. Sie verlor nicht nur Wähler, sondern auch das Wohlwollen der Gewerkschaften. Umso bemerkenswerter ist, dass sich der heutige SPD-Chef auf den Agenda-Kanzler beruft. „Schröder hat mutige Reformen angepackt“, sagte Lars Klingbeil unlängst. „Auch heute brauchen wir umfassende Reformen, damit unser Sozialstaat stark, aber auch bezahlbar bleibt und besser funktioniert.“ Klingbeil weckte damit in den Reihen der Union Hoffnungen, der von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angekündigte „Herbst der Reformen“ könnte tatsächlich wahr werden.
Wann macht Merz den Schröder?
Nicht nur die SPD, auch die CDU hat vermutlich genau die Analyse des Meinungsforschungsinstituts Allensbach studiert, der zufolge die Bürger zwar den Reformbedarf im Land sähen, aber nicht bereit seien, selbst mit Einschnitten zur Lösung beizutragen. Vor nicht allzu langer Zeit wollte Kanzler Friedrich Merz noch die auf mehr als 50 Milliarden Euro gestiegenen Ausgaben für das Bürgergeld um zehn Prozent kürzen. Nach dem jüngsten Koalitionsausschuss klang das anders. Die Koalition sei sich einig, dass sie den Sozialstaat erhalten wolle. „Wir wollen ihn nicht schleifen, wir wollen ihn nicht abschaffen, wir wollen ihn nicht kürzen.“ Frustrierte Beobachter spotten schon: Macht Merz jetzt die Merkel? Optimistischere Zeitgenossen fragen mit Blick auf den wachsenden Druck des Faktischen: Wann macht Merz den Schröder?
Reformkanzler Schröder und Superminister Clement
Wie sich die Zeiten ähneln: Sozialabgaben von 42 Prozent des Bruttolohns mit steigender Tendenz, beharrlich steigende Arbeitslosigkeit, begleitet von immer größeren Löchern in Sozial- und Staatskassen. Das war der giftige Mix, mit dem die Regierung Gerhard Schröder (SPD) nach den „goldenen Jahren“ von 1998 bis 2000 fertig werden musste. Aufschwung passé, die Wirtschaft lahmte, der Standort Deutschland lockte keine Investitionen mehr an. Und mit dem Schock der Anschläge vom 11. September 2001 kam noch eine plötzlich instabile Weltlage hinzu.
Zunächst hatte Schröder sich erhofft, in einem „Bündnis für Arbeit“ einen breiten Reformkonsens mit Gewerkschaften und Arbeitgebern zu schmieden. Das verlängerte aber nur die politischen Blockaden. Dann hatte er genug. Anfang 2003 ließ Schröder das Bündnis platzen und handelte auf eigene Faust. Es folgte die „Agenda 2010“ mit Arbeitsmarktreformen, die heute vor allem durch den Begriff „Hartz IV“ in Erinnerung sind. Diese Reform zur Grundsicherung für Arbeitssuchende, heute Bürgergeld, war nur eines von vier Gesetzen „für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“. Ihre Inhalte hatte eine von Schröder 2002 – neben dem Bündnis für Arbeit – berufene Kommission erarbeitet. Sie trug, wie die vier Gesetze, den Namen ihres Vorsitzenden, des VW-Personalvorstands und Schröder-Vertrauten Peter Hartz.
Mit Hartz I wurde unter anderem die bis dahin gesetzlich eng begrenzte Zeitarbeit dereguliert. Hartz II lockerte die Regeln für Minijobs und brachte die „Ich-AG“, eine damals neuartige Existenzgründerförderung, um Arbeitslosen auch Wege in die Selbständigkeit zu weisen. Hartz III stellte die in altem Behördengeist gefangene Bundesanstalt für Arbeit ganz neu auf, mit dem Leitbild eines effizienzorientierten Dienstleisters. Und dann Hartz IV, das brisanteste Gesetz, gegen das sogar der frühere SPD-Chef Oskar Lafontaine auf „Montagsdemonstrationen“ nach Art der DDR-Revolution von 1989 protestierte; nachdem er im Streit mit Schröder aus Regierung und Partei geflüchtet war.
Hartz IV schaffte die alte Arbeitslosenhilfe für Langzeitarbeitslose ab, deren Höhe sich am früheren Lohn orientierte, und erzeugte Druck, auch Einfachjobs anzunehmen. Für einst beruflich bessergestellte Langzeitarbeitslose war das hart. Hartz IV ersetzte zudem die alte Sozialhilfe, soweit sie für Arbeitslose zuständig war. Zu Schröders Unglück aber trieb die Reform die Arbeitslosenzahl erst weiter hoch, indem sie verdeckte Arbeitslosigkeit offenlegte. Im Februar 2005 wurde der Rekord von 5,3 Millionen erreicht. Politisch leitete dies das Ende der Regierung ein. Die Erfolge kamen zu spät: Im November 2005 wurde Angela Merkel Kanzlerin, zwei Monate später sank die Arbeitslosigkeit.
Den ersten Anlass zu den Hartz-Reformen hatten indes nicht akute Wirtschafts- und Haushaltsnot geliefert: Ein Skandal um manipulierte Arbeitsmarktstatistiken der Bundesanstalt für Arbeit erwischte die Regierung Schröder im Januar 2002, kurz vor der Bundestagswahl, und brachte sie in politische Nöte. Der Kanzler reagierte sofort mit der Einsetzung der Hartz-Kommission, um Öffentlichkeit und Opposition Tatkraft und Reformwillen zu zeigen.
Im Herbst 2002 ging es für Wahlsieger Schröder dann ans Umsetzen, getrieben durch den Teufelskreis immer mieserer Rahmendaten. Dazu krempelte er die eigene Regierung um, legte Arbeits- und Wirtschaftsministerium zusammen und machte Wolfgang Clement, zuvor Regierungschef in NRW, zum „Superminister“. Der hatte den harten Job, all die Reformgesetze um- und durchzusetzen: gegen empörte Gewerkschaften, gegen wachsende Widerstände der eigenen Partei und gegen eine schwarz-gelbe Opposition, angeführt von Angela Merkel, der damals alle Reformpläne zu lasch waren.

Walter Riester und die Rente
Arbeitsminister Walter Riester (SPD) schaffte im Jahr 2001, was wenigen Politikern gelingt: ein Gesetz, das sich dauerhaft mit seinem Namen verband. Die Riester-Rente steht bis heute für die private Zusatzaltersvorsorge, soweit sie staatlich gefördert ist. Später wurde viel über ihre Mängel diskutiert, nur geändert haben die Kritiker nichts. Vor allem aber steht sie für eine Reformradikalität, die man sich heute kaum vorstellen kann: Riester, der zuvor Vizechef der IG Metall gewesen war, brach mit dem Prinzip, dass die beitragsfinanzierte Rente allein ausreichen müsse, um den Lebensstandard im Alter zu sichern.
Seine Rentenreform 2001 brachte nicht nur Fördergeld für die Privatvorsorge. Mit der sogenannten Riester-Treppe kürzte sie zugleich die jährlichen Rentenerhöhungen radikal, um die Zahler zu entlasten. Die neue geförderte Privatvorsorge sollte die Lücken füllen. Im Ergebnis fügte diese Reform der umlagefinanzierten Rente ein wichtiges Element der Kapitaldeckung hinzu und trug auch mit den Riester-Kürzungsstufen stark zu deren Stabilisierung im demographischen Wandel bei.

Spätere Regierungen haben sich – Stichworte: Mütterrente, Rente ab 63 – darauf ausgeruht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Riester 1998 völlig anders gestartet war. Nach ihrem Wahlsieg schaffte die rot-grüne Koalition zunächst den Demographiefaktor ab, damit die Rente stärker steige. Hohe Arbeitskosten (Rentenbeitrag 20,3 Prozent) erhöhten aber auch die Arbeitslosigkeit. Erst zahlte die Regierung mehr Steuergeld an die Rentenkasse, finanziert über eine höhere Mineralölsteuer („Rasen für die Rente“). Als das ausgereizt war, begann die Flucht nach vorn. Riesters Nachfolgerin Ulla Schmidt führte später auch den Demographiefaktor wieder ein. Und Franz Müntefering setzte schließlich die Erhöhung der Altersgrenze auf 67 Jahre obendrauf.
Hans Eichel und der Etat
Zum Amtsantritt gab es eine Lücke von 30 Milliarden Mark im anstehenden Bundeshaushalt, die Finanzminister Hans Eichel (SPD) in wenigen Monaten schließen musste. Der Nachfolger von Oskar Lafontaine, der aus der Regierung geflüchtet war, verteilte Einsparvorgaben an die Ministerien für Verteidigung, Arbeit, Wirtschaft und Äußeres, er bereitete auch Eingriffe in Leistungsgesetze vor, etwa die Beschränkung der Rentenerhöhungen auf einen Inflationsausgleich.

Nicht alles konnte er durchsetzen, aber doch das meiste. Nach dem Vermittlungsverfahren mit den Ländern bezifferte er die erreichten Einsparungen auf 28,2 Milliarden Mark. Damals musste der Hesse seine politische Karriere nicht riskieren, um das durchzusetzen, was er für richtig hielt, sie war mit seinem Wechsel in die Bundespolitik ohnehin unverhofft in die Verlängerung gegangen (in Wiesbaden war er abgewählt worden). Zudem hatte er da noch die Rückendeckung des Kanzlers. Auf seiner Habenseite steht außerdem eine Steuerreform, die Kapitalgesellschaften sofort und alle anderen Steuerpflichtigen in drei Stufen entlasten sollte.
Doch die schlechte Wirtschaftslage machte seine Finanzplanung zur Makulatur. In den folgenden Koalitionsverhandlungen gelang es ihm nicht, mit einem zweiten Sparpaket seinen Sparkurs abzusichern. Gerhard Schröder wies ihn mit dem Zuruf zurecht: „Hans, lass mal gut sein.“ Direkt danach der Offenbarungseid. Eichel gestand, dass Deutschland wahrscheinlich die Defizitgrenze aus dem Stabilitätspakt überschreiten werde. Der Kanzler sorgte dafür, dass es keinen Blauen Brief aus Brüssel gab. Der Preis war hoch, der Stabilitätspakt entwertet. Ausgerechnet von den Deutschen, die ihn durchgesetzt hatten. Eichel machte trotzdem weiter. Den ausgeglichenen Haushalt durfte er im Amt nicht mehr erleben.
Ulla Schmidt und die Gesundheit
Im Januar 2001 mussten Agrarminister Karl-Heinz Funke (SPD) und Gesundheitsministerin Andrea Fischer (Grüne) zurücktreten, weil sie die Rinderseuche BSE nicht in den Griff bekamen. Plötzlich hieß es, Ulla Schmidt könnte Ministerin werden, doch sie selbst glaubte nicht daran. Denn als SPD-Abgeordnete konnte es ja nur um Funkes Nachfolge gehen, an dessen Themen sie kein Interesse zeigte. Doch Gerhard Schröder (SPD) und Joschka Fischer (Grüne) hatten anderes im Sinn: Renate Künast (Grüne) wurde Agrar- und Schmidt Gesundheitsministerin. Von der Materie verstand sie nicht viel, aber sie war interessiert – und behielt den Posten dann bis 2009, länger als jeder andere Amtsinhaber.

In diese Zeit fallen wichtige Entscheidungen wie die Einführung des Bundeszuschusses zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) oder 2009 des Gesundheitsfonds. Das GKV-Modernisierungsgesetz von 2003/2004 passte zur „Agenda 2010“ und den Hartz-IV-Reformen. Der Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt ging es schlecht, das GKV-Defizit überstieg die Drei-Milliarden-Euro-Marke. Schmidt musste durchsetzen, was sich die meisten Sozialpolitiker bis heute nicht trauen: Leistungen kürzen, Eigenbeteiligungen verlangen, sich mit der großen Wählergruppe der Rentner anlegen.
Sie führte eine Praxisgebühr ein, erhöhte die Zuzahlung im Krankenhaus, schaffte die Erstattung verschreibungsfreier Arzneien ab, schränkte jene für Brillen und Taxifahrten ein, strich das Sterbegeld der GKV. Kurzfristig auch Sozialministerin, setzte sie 2004 den Nachhaltigkeitsfaktor in der Rente durch, den ihre Partei heute wieder aussetzen will. Es war aber auch Tricksen dabei, etwa als Schmidt den Zahlungstermin der Unternehmen für die Sozialbeiträge so vorverlegte, dass sie die Abgaben 2006 dreizehnmal abführen mussten.