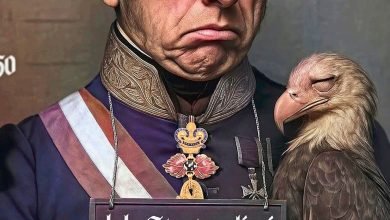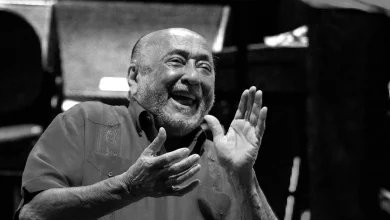Musikbranche im KI-Zeitalter: Musik, die nicht egal ist | ABC-Z

Der Warnstreik, der daraufhin erfolgte, war der erste Streik, den Angestellte einer Socia-Media-Plattform in Deutschland durchführten.
Den Algorithmus trainieren und trotzdem leer ausgehen? So könnte es mittelfristig auch den Musikschaffenden gehen. Im Unterschied zu beispielsweise den Mitarbeitenden von TikTok wissen die aber oft noch nicht einmal, ob und wie stark ihr künstlerischer Output genutzt wird, um die KI zu füttern.
Die Plattformen Suno und Udio
Die Start-ups Suno und Udio gehören zu den führenden Plattformen hinsichtlich der generativen Erstellung von Musik. Nur kurz das Genre und ein Thema für den Song ausgewählt (in meinem Fall ein Song über Drehtabak, Genre: Postpunk) und das Programm spuckt einem – wortwörtlich – einen Song aus. Der ist dann, was den künstlerischen Mehrwert angeht, in etwa so egal, wie es der Prompt ist, der ihm ins Leben geholfen hat.
Um dies leisten zu können und beispielsweise jedem Genre einen bestimmten Klang, eine bestimmte Ästhetik zuordnen zu können, müssen Suno und Co im Vorfeld mit großen Datensätzen versorgt worden sein, durch die sie lernen konnten, wie die jeweilige Musik klingt. Woher genau diese Daten allerdings stammen und welche Musik eingespeist wurde, darüber wird vonseiten der Unternehmen Stillschweigen bewahrt. Zu groß ist wohl die Angst, dass das Thema Urheberrecht doch noch eine Rolle spielen könnte.
Die Frage danach kommt spätestens dann zum Tragen, wenn mittels der KI-Tools nicht nur rum gespaßt wird, um zum Beispiel einen Song über die beste Freundin generieren zu lassen, sondern wenn daraus „Musik“ wird, die nach Veröffentlichung auf eine große Zahl an Hörerinnen stößt.
Keine Newcomer-Band
So wie kürzlich bei der „Band“ „The Velvet Sundown“ geschehen. Die wartet mit „Songs“ auf, deren Titel genau so random sind wie der Bandname auch („Dust On The Wind“, „As The Silence Falls“, „End The Pain“), und erreicht damit mittlerweile über 1,3 Millionen Hörer.
Viel wurde darüber geschrieben, der Output von „The Velvet Sundown“ teilweise besprochen, als würde es sich einfach um Newcomer handeln. Festgestellt wurde dabei dann unter anderem, dass es ja gar keine Konzertankündigungen gibt. Große Überraschung.
Was abseits allen Zynismus wirklich überrascht, ist dann doch, wie unkritisch manch ein Musikjournalist mit der zusammengenerierten Musik umgeht, teilweise selbst immer wieder damit experimentiert und ganz begeistert ist. Wenn das der Weg der Wahl ist, dann wird man den Musikjournalismus bald auch in Anführungszeichen setzen können, denn wer könnte KI-Musik besser besprechen als eine KI?
Nur Deezer weist KI-Songs aus
Um ein Randphänomen handelt es sich dabei schon länger nicht mehr. Zu Beginn des Jahres veröffentlichte Deezer, der einzige Streamingdienst, der KI-Songs explizit auch als diese ausweist, Zahlen dazu. 18 Prozent aller neu hochgeladenen Songs sind generiert. Das sind pro Tag mehr als 20.000.
20.000 Songs, die ohne Produktionskosten in die Welt geworfen werden und dem Schaffen von Künstlerinnen und Künstlern gegenüberstehen, die selbst von ihrer Musik leben wollen, die Studios und Proberäume, Mixing und Mastering und vieles mehr bezahlen müssen.
Die haben ohnehin schon mit den Bedingungen zu kämpfen, die Streamingdienste wie Spotify geschaffen haben. Eine Musiklandschaft, in der sich alles um die Vermarktung ihrer Musik auf sozialen Medien und Playlistplatzierungen dreht. Letztere bringen einen ganz neuen Zweig an Musikpromotiontools hervor, von denen es mittlerweile unzählige zu geben scheint.
Reale Hörerschaft im Fokus
Das Geschäftsmodell? Die Musik der Artists durch Bezahlung in Playlisten unterzubringen und Hörerinnen zu generieren. Wobei hier explizit mit realer Hörerschaft geworben wird, Bots also außen vor bleiben sollen.
Albrecht Schrader zum Beispiel, ein Musiker, über den in jedem Fall mehr geschrieben werden sollte als über „The Velvet Sundown“ und Co, teilte vor einigen Tagen in seinen Instagram-Stories Screenshots von Werbung dieser Online-Musikpromotiontools, die ihm in seinen Feed gespült wurde.
Sein letzter Storyslide war dann ein Dreipunkteplan, um mit diesem Irrsinn umzugehen. Dieser lautet wie folgt: „1. Die Scheiße erkennen, 2. Die Scheiße benennen, 3. Der Scheiße gutes Zeug entgegensetzen.“ Laut Schrader darf gerne ergänzt und gemeinsam umgesetzt werden.
Mittels KI-Songs könnten Musiker endgültig aus dem Rennen gedrängt werden
Bevor dieser Text versucht, auf Punkt drei einzugehen, noch einmal zu Punkt Nummer zwei. Die Scheiße benennen. Zugegebenermaßen ist das ein sehr großes Vorhaben, aber irgendwo muss man ja anfangen.
Spotify ist auch dabei
Wie immer, wenn es um die Kaputtheit der Musikindustrie geht, ist Spotify nicht weit, denn auch dort ist man sich sicherlich bewusst darüber, wie viel Geld man einsparen kann, wenn man Musikerinnen künftig nicht mehr ihre 0,003 Cent pro Stream, sondern einfach gar nichts mehr ausbezahlen muss.
Bei Film- und Serien-Streamingdiensten sind Eigenproduktionen bereits gang und gäbe. Warum also nicht auch im Musikstreaming? Nach der Devise „Flood the Market with shit“ könnten Musiker hier mittels KI-Songs endgültig aus dem Rennen gedrängt werden.
Zusätzlicher Bonuspunkt: Von den KI-Artists beschwert sich auch niemand, wenn Spotify-CEO Daniel Ek Millionenbeträge in Rüstungsunternehmen investiert. Das war für einige Künstlerinnen (zum Beispiel King Gizzard & The Lizard Wizard) nämlich Anlass dazu, ihre Musik von der Plattform zu nehmen. Damit wäre die Problematik erst einmal benannt und die rosigen Zukunftsaussichten sind niedergeschrieben.
Besser: gutes Zeug hören
Zeit also, gutes Zeug entgegenzusetzen. Das ist eigentlich der einfachste Punkt, denn gute Musik gibt es bereits. Schwer wird es, eine Auswahl zu treffen, weswegen die Autorin nun einfach Artists empfiehlt, deren Musik sie in den letzten Tagen gelauscht hat.
Namentlich sind das zum Beispiel Betti Kruse aus Hamburg, die mit ihren deutschen Chansons an Musikerinnen wie Hildegard Knef anknüpft; Midwife – die US-amerikanische Musikerin hat in diesem Jahr gemeinsam mit Matt Jencik die Platte „Never Die“ veröffentlicht, wunderbar düster und melancholisch; und zum Schluss noch Baxter Dury allgemein und im Speziellen seinen Song „Allbarone“, der zusammen mit JGrrey entstanden und super tanzbar ist. KI could never.
Was KI übrigens auch nicht kann? Streiken und sich in Gewerkschaften organisieren. Jedenfalls noch nicht. Vielleicht also auch Zeit für Musiker:innen, sich einmal den Slogan „We trained your machines. Pay us what we deserve“ auf die Streikfahnen zu schreiben?