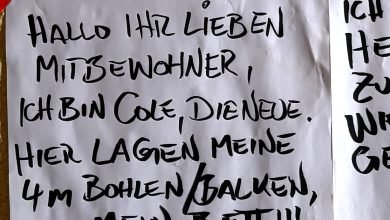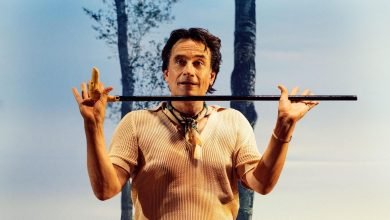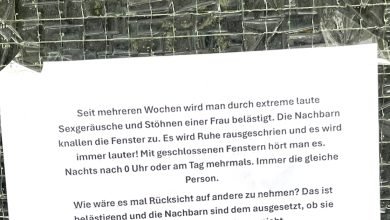Diese Lebensereignisse greifen das Gehirn an | ABC-Z

Berlin. Ein Partner stirbt, die Arbeit geht verloren – und das Gehirn verändert sich. Forscher zeigen, wie dies das Alzheimer-Risiko erhöhen kann.
Der Verlust eines geliebten Menschen, Arbeitslosigkeit oder finanzielle Not: Solche Schicksalsschläge hinterlassen nicht nur seelische Narben. Sie können offenbar auch unser Gehirn messbar verändern und das Risiko für Alzheimer erhöhen. Das legt eine neue Studie aus Barcelona nahe, die im Fachjournal Neurology erschienen ist.
Ein Forscherteam des Barcelonabeta Brain Research Centre untersuchte 1.290 Erwachsene zwischen 45 und 75 Jahren, die alle ein familiär erhöhtes Risiko für Alzheimer hatten, aber zum Zeitpunkt der Untersuchung keine kognitiven Einschränkungen zeigten. Sie wollten wissen: Was passiert im Gehirn, wenn Menschen mit schweren Lebensereignissen konfrontiert werden?
Alzheimer & Demenz: Gedächtnis in Gefahr
Die Studie zeigte: Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die den Tod ihres Partners erlebt hatten, zeigten im Nervenwasser (Liquor) biologische Anzeichen, die mit Alzheimer in Verbindung stehen. So fanden die Forscher vermehrt Eiweißstoffe wie Beta-Amyloide, Tau-Protein und Neurogranin, also Biomarker, die auf Nervenzellschäden und Synapsenverlust hindeuten.
Doch nicht nur Trauer, auch wirtschaftlicher Druck kann offenbar das Gehirn verändern. Arbeitslosigkeit oder finanzielle Einbußen gingen mit einer messbaren Schrumpfung bestimmter Hirnregionen einher, vor allem im sogenannten Gyrus cinguli, der für emotionale Verarbeitung und Verhaltenssteuerung verantwortlich ist.
Ein FUNKE Liebe
Alle zwei Wochen sonntags: Antworten auf Beziehungsfragen – ehrlich, nah und alltagstauglich.
Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der
Werbevereinbarung
zu.
Interessant ist, dass nicht alle Menschen gleich auf Stress reagieren. Männer wiesen nach dem Verlust des Partners oder nach Jobverlust häufiger Alzheimer-typische Veränderungen auf, insbesondere, wenn sie einen niedrigeren Bildungsabschluss hatten. Frauen reagierten sensibler auf finanzielle Krisen: Bei ihnen stiegen die Marker für Nervenzellschäden besonders stark.
Stress als stiller Risikofaktor für Alzheimer und Demenz
Was steckt hinter diesen Veränderungen? Die Forscher vermuten, dass chronischer Stress über mehrere Wege zu Hirnschäden führen kann, etwa durch die andauernde Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol, die das Nervensystem belasten. Hinzu kommt: Wer leidet, bewegt sich oft weniger, schläft schlechter, isst ungesünder. All das kann das Alzheimer-Risiko zusätzlich erhöhen.
Ein zentrales Fazit der Studie: Wer unter schweren Schicksalsschlägen leidet, sollte psychologische Unterstützung erhalten, nicht nur aus psychischen, sondern auch aus neurologischen Gründen. Denn Stressbewältigung könnte ein Baustein zur Prävention von Alzheimer sein.
Noch ist allerdings nicht abschließend geklärt, ob auch Menschen ohne familiäre Vorbelastung von solchen hirnphysiologischen Veränderungen betroffen sind.