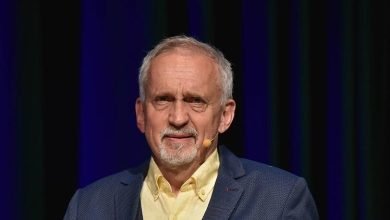Impulstanz Festival Wien: Schweiß und Pathos | ABC-Z

Immer wieder verheddert sich eine Tänzerin in der Drehtür zur Hinterbühne. Der Mechanismus, der in der Beschleunigung nur rasenden Stillstand erzeugt, wird zum Emblem von Entfremdung, die noch in die entlegensten Reservate des Privaten dringt. Gesellschaft ist in den leeren Stuhlreihen des „Café Müller“, Pina Bauschs Stück anno 1978, auch außerhalb der Öffnungszeiten immer präsent.
Es spannt eine somnambule Zwischenwelt auf, in der die Subjekte im Blindflug einander begehren und zuverlässig verfehlen. Ein Tänzer räumt der schlafwandelnden Protagonistin die Stühle aus dem Weg. Mehr kann man in Zeiten wie diesen füreinander nicht tun. Die Rollen in Paarbeziehungen stehen außer Frage, vielleicht scheitern sie gerade daran.
Den elfenhafte Frauenleib vermögen die kraftlos-starken Männerarme nicht zu halten. Heterosexualität ist hier noch das kulturelle Normalnull, aber verbunden mit dem Verweis auf eine unentrinnbare Gewaltgeschichte. Warum zeigt man Stücke, über die alles gesagt scheint, deren letzte Winkel seit Jahrzehnten beschrieben und erforscht sind?
Das Festival geht auf historische Exkursionen
Das Wiener Impulstanz Festival geht nicht zum ersten Mal auf Exkursionen in die Tanzgeschichte, die, soweit sie bis in die 1980er Jahre zurückreicht, auch seine eigene ist. Es hat sich aus überschaubaren Anfängen zum größten europäischen Tanzfestival entwickelt.
Die Pluralität seiner Programmierung verfolgt weniger das kuratorische Interesse an einer hegemonialen Positionierung innerhalb der Tanzszene als letztlich eine kulturpolitische Mission: Tanz langfristig in einer Stadt zu etablieren und zu kanonisieren, in der er zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr präsent war, während er in der Rekonstruktion einer österreichischen kulturellen Identität nach dem Nationalsozialismus jenseits des Balletts für Jahrzehnte kaum noch vorkam.
Unterdessen wird der Begriff des Zeitgenössischen im Tanz zunehmend unklar. Was verbindet die virtuosen Arbeiten der „alten Meister:innen“, die dem Festival die Spielstätten füllen, noch mit den fragilen Selbsterkundungen seiner Nachwuchsprogramme?
Die Aufspaltung künstlerischer Praxis, die sich kaum mehr über methodische und theoretische Perspektiven verständigt, macht die Frage, wie all diese Differenzierungen entstanden sind, immer dringlicher. In „Café Müller“, der Neueinstudierung von Boris Charmatz, dem scheidenden Intendanten des Tanztheater Wuppertal, sind es durchweg junge Tänzer:innen, die sich ein fernes Repertoire aneignen.
Die Differenz der aktuellen und der historisch geronnenen Körpererfahrung erst öffnet eine Ebene der Reflexion. Um Gegenwart als Gewordenes zu begreifen, braucht es das Archiv. „Nelken“ (1982), das zweite Pina-Bausch-Stück im Programm, treibt die Studie gesellschaftlicher Mikroaggression weiter.
Im Meer von Kunstblumen kehrt das Bild einer Gesellschaft wieder, die nach einem sehr kurzen Jahrzehnt, das mehr Demokratie zu wagen versprach, in ihren Kontrollmechanismen erstarrt. Daran irritiert vor allem, das heute alltäglich erscheint, was damals noch verstörte.
Das Programm von Impulstanz lässt sich in seiner ersten Halbzeit auch als horizontale Erzählung über Formen der Vergesellschaftung zu verschiedenen Zeiten lesen. Der Vorlauf auf der Zeitachse führt in die Postpandemie zu „In C“ von Sasha Waltz and Guests, die erstmals überhaupt bei Impulstanz vertreten sind.
Irgendwann verschwindet das Hetero-Drama
Das Frau-Mann-Drama ist vorläufig aus dem Zentrum verschwunden. Im Narkotikum der Musik von Terry Riley und den Schöne-Neue-Welt-Farben des Virtuellen tummelt sich ein Schwarm von Monaden getrieben von Individualkonkurrenz, sozialer Distanzierung und dem gegenläufigen Begehren, sich in labilen Konstellationen körperlich zusammenzurotten.
In der aktuellen Arbeit von Alexander Vantournhout kehrt das Paarschema dagegen wieder. „every_body“ im Duett mit Emmi Väisänen erfindet den Pas de deux als Form artistischer Funktionalität neu. Dabei gelingt oder unterläuft ihnen ein wunderbares Bild. Seitlich ineinander verschränkt setzen sie symmetrisch auf einem Laufband einen Fuß vor den anderen.
Als Einzelne könnten sie die Vertikale darauf nicht halten, gemeinsam bewältigen sie den Vortrieb des Laufbands. Das Paar wird als symbiotisches Zweckbündnis zur Ikone eines alle Lebensbereiche durchdringenden Verwertungszwangs.
Der südkoreanische Choreograf Kyoung Shin Kim und sein Ensemble Unplugged Bodies betreiben eine tänzerische Transformation dystopischer Arbeitswelten. „Homo Faber – the Origin“ führt in eine Art Vertriebszentrum für Internetbestellungen, in denen ein Arbeiter:innenheer in graubraunen Overalls Kartons verschiebt.
Immer wieder treibt sie eine autoritative Lautsprecherstimme à la „Squid Game“. Hier im Außenbereich einer digitalen Ökonomie herrscht Schweiß statt Information und elektronische Tags sorgen dafür, dass die Pakete schnell genug bewegt werden.
Tanzen im postindustriellen Jammertal
Die der Effizienz der Arbeit unterworfenen Tänzer:innenkörper gewinnen ihrem postindustriellen Jammertal unerwartete Wendungen ab, werfen als Maschinenstürmer Steine, um den Maschinen doch zu unterliegen.
Kyoung Shin Kim wechselt, wie der Titel will, von der Ökonomie in die Ontologie, was nicht zu den stärksten Momenten des Abends gehört. Was eben noch entfremdete Arbeit war, wird zum Makel im Dasein eines Mangelwesens. Die biologische Evolution hält mit der technischen nicht mit. War’s das mit der Spezies?
Es bleiben opulente Bilder, die auch Pathos nicht scheuen. Zum zweiten Schostakowitsch-Walzer schleudern Sprünge auf eine Wippe rotes Blütenkonfetti durch die Luft. Ist es Love Bombing oder die Ankündigung des unvermeidlichen Krieges?
Kyoung Shin Kim dreht in philosophischer Spekulation am großen Darstellungsrad. Aufgeklärte Skepsis, die überall Pathos und Ideologieverdacht wittert, kann das irritieren. Aber vielleicht braucht es gerade das, vielleicht ist, was einst Skepsis und Sorgfalt war, selbst längst Ideologie und als solche nur noch wissendes Einverständnis ins Bestehende.
Erst spät schlägt das Thema „Pandemie“ im Tanz ein
Mit Roland Barthes’ „Fragmente einer Sprache der Liebe“ im Gepäck nähert sich die Wiener Choreografin Elisabeth Bakambamba Tambwe zwei Figuren der griechischen Mythologie, dem ins eigene Spiegelbild verliebten Narcissos und der zum Nachhall Echo. Die Performance „SelFist“ liest den Mythos im Hinblick auf die Allgegenwart medial gestützter Selbsttechniken neu.
Der/die nonbinäre, künstlerisch im Ballhaus Naunynstraße in Berlin beheimatete, britische Performancekünstler*in Bishop Black, der Wiener Schauspieler Max Mayer und die Performerin Sunny Jana bearbeiten in einer von Musik und komplexen Videoprojektionen gestützten Performance ein populär- wie subkulturelles Bombardement von Identifikationsangeboten. Narziss wird mit ihnen zum Forscher, der die Fremdzuschreibungen verweigert.
Zu den überraschenden Momenten des Festivals gehört, dass das Thema Pandemie erst jetzt mit Zeitverzug richtig durchschlägt. Mette Ingvartsen etwa inszeniert mit „Delirious Night“ einen postpandemischen Maskenball, der sich über eine Stunde steigert, gleich dem mittelalterlichen Schreckensbild einer besessenen Tanzwut.
Es mehren sich Arbeiten, die auf diskursive Volten pfeifen und die Lust am Einssein mit dem bewegenden Körper als kollektive Erfahrung vermitteln. Eine „Inflationsperiode performativer Zeichenhaftigkeit“, die ein Wiener Kritiker noch diagnostiziert, scheint zu Ende zu gehen.