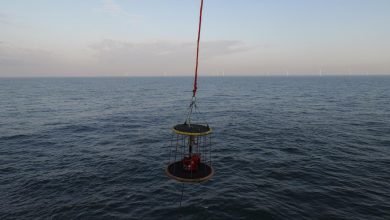Anja Blacha ist die erfolgreichste deutsche Höhenbergsteigern | ABC-Z

Es ist ein Traumbild für viele, vielleicht auch eine Phantasie: allein auf dem Gipfel des Mount Everest zu stehen. Am höchsten Punkt der Welt, in 8848 Meter Höhe. Anja Blacha hat das erlebt. Sie stand ganz oben, ohne Führer, ohne Träger, ohne andere Bergsteiger. Ein ergreifender Moment?
Nein, sagt sie, so habe sie das nicht empfunden. „Es lag viel Müll am Gipfel, die ganzen Fahnen, mit denen die Leute Fotos gemacht haben, Müsliriegelpapiere, anderes mehr. Als ich ankam, pickten dort Vögel im Müll.“ Erhabene Gefühle kamen da nicht auf. Auch wegen der Erlebnisse zuvor. „Am Hillary Step liegt die Leiche eines Bergsteigers auf der Route, am Gipfelgrat führt der Weg an einer weiteren Leiche vorbei.“ Was geht einem durch den Kopf, wenn man an einem Toten vorbeisteigt? „Es ist vor allem ein Mahnmal“, sagt Anja Blacha. „Dass man hier in der Todeszone ist. Dass man hier wieder runtermuss. Ein Fehler, und es rettet einen keiner.“
Es war Anja Blachas dritter Aufstieg auf den Mount Everest. Zweimal hatte sie es mit Flaschensauerstoff geschafft, nun, am 27. Mai 2025, erstmals ohne. Eine körperliche Grenzerfahrung? „Ich war extrem gut akklimatisiert“, sagt sie, „und das hat sich ausgezahlt. Ich war die gesamte Zeit zu 100 Prozent klar.“ Im Jahr 2021, bei ihrem zweiten Gipfelerfolg, war sie schon bis auf 8400 Meter ohne Flaschensauerstoff aufgestiegen, „aber damals habe ich ganz anders gekämpft“. Diesmal kam sie langsam, aber stetig voran. Vom Südgipfel (8750 Meter) bis zum Gipfel und auf dem gesamten Rückweg zurück zum Südsattel (7900 Meter) war sie ganz für sich. „Es war superschön“, sagt die 35 Jahre alte Höhenbergsteigerin. „Ich liebe das, wenn man runterkommt und das Wolkenspiel beobachten kann, das gesamte Panorama vor sich hat. Im Aufstieg sieht man ja meist nur die paar Schritte vor sich.“
Die jüngste Deutsche auf den Seven Summits
Ein Sommertag in Zürich, Anja Blacha sitzt in einem Café nicht weit von der Seepromenade. Seit 2016 ist sie in der Schweizer Hauptstadt zu Hause, zum Gespräch ist sie mit dem Rad gekommen. Zwei Wochen liegt es da erst zurück, dass sie mit ihrem Erfolg am Everest Aufsehen erregt hat. In seiner Everest-Bilanz der Frühjahrssaison 2025 schrieb der renommierte amerikanische Alpinexperte und Blogger Alan Arnette: „Eine Bergsteigerin ragte heraus: Eine deutsche Alpinistin, Anja Blacha, schaffte einen Beinahe-Solo-Aufstieg.“ Herausragend war das schon deshalb, weil der Anteil der Bergsteiger, die ohne Flaschensauerstoff den Mount Everest angehen oder gar besteigen, bei ein bis zwei Prozent liegt.
Anja Blacha hat nun zwölf Achttausender ohne Flaschensauerstoff bestiegen, mit kommerziellen Expeditionen – so viele wie keine andere deutsche Bergsteigerin. Sie war die jüngste Deutsche auf den Seven Summits, den höchsten Gipfeln der Kontinente, die erste Deutsche auf K2 (8611 Meter), Kangchendzönga (8586), Annapurna (8091) und Gasherbrum I (8080), die erste Deutsche, die ohne zusätzlichen Sauerstoff auf den Everest stieg.
Die Rekorde, sagt sie, seien für sie aber nicht entscheidend. Und schon gar nicht seien sie ihr Antrieb. Der liege eher im Erleben außergewöhnlicher Momente und Natureindrücke: der monumentalen Berge, des verwehenden Schnees, der Sonnenuntergänge und des Sternhimmels im Hochlager. „Das zahlt viel zurück“, sagt sie. „Man hat da oben viel Belohnung, viele Wow-Momente. Man kommt immer wieder ins Staunen.“
Aufgewachsen ist Blacha ohne Berge
Als Pioniertaten sieht sie ihre Leistungen ohnehin nicht, Rekorde hin oder her. „Es wäre eine Pioniertat gewesen, wenn es vor 20 Jahren passiert wäre. Mittlerweile haben wir die Achttausender so gut verstanden: wie wir sie erschließen können, wie wir sie besteigen können, welche Risiken wir eingehen können, wie die Wetterfenster spielen, dass es sich nicht mehr wie eine Pionierleistung anfühlt.“
Eindrucksvoll sind ihre Leistungen trotzdem. Erst recht vor dem Hintergrund ihrer Biographie. Aufgewachsen ist Anja Blacha in Bielefeld. In Ostwestfalen. Ohne Berge, ohne Interesse an Bergen, ohne nur einen Gedanken daran, ob Berge sie interessieren könnten oder nicht. „K2 war für mich eine Inline-Skating-Marke.“ Sie war Fechterin und Reiterin, studierte in Mannheim BWL, war zum Auslandsstudium an der University of California in Berkeley und absolvierte ein Masterstudium der Philosophie in London. Stieg als Managerin bei Vodafone ein, im Technikbereich, betreute ein Jahr lang Partnermärkte in Afrika, verhandelte etwa mit nigerianischen Unternehmenschefs, und wechselte später zu Swisscom in die Schweiz. Eine eindrucksvolle Karriere, in fast jeder Hinsicht. Nur eben nicht in alpinistischer.

2013 dann reiste Anja Blacha mit ihrer Schwester zum Backpacken nach Peru. „Da habe ich gemerkt, wie ich dieses Naturerleben vermisst habe“, sagt sie. Die Erfahrung wirkte so stark nach, dass sie umgehend ihr nächstes Ziel suchte – und im Aconcagua (6961 Meter) fand, dem höchsten Berg Amerikas. Der Aufstieg klappte, sie kam mit der Höhe gut klar, und so führte ein Berg zum anderen, ein Tipp zum nächsten. 2017, vier Jahre nach Peru, war sie erstmals am Mount Everest. Eine steile Karriere.
Man muss sich was zutrauen
Kamen ihr nie Zweifel, ob die Ziele vielleicht zu schnell zu hoch geworden sein könnten? „Die offensichtlichen Hürden sind ja nicht immer die schwierigsten“, sagt Anja Blacha. „Der Everest ist was ganz anderes als die Eiger-Nordwand. Das eine braucht Resilienz, Höhenverträglichkeit, strukturelles Rangehen, Kräfte einteilen. Das andere braucht hochtechnische bergsteigerische Fähigkeiten. Und das eine habe ich eher als das andere.“ Aber klar: Man müsse sich was zutrauen. „Für mich ist das Entscheidende immer gewesen: Ich habe mich getraut, hinter die Kulissen zu schauen.“
Herauszufinden, was es für ein Ziel braucht, wie es machbar ist. So erarbeitete sie sich nicht nur den Weg an die höchsten Berge. Von November 2019 bis Januar 2020 marschierte sie in 58 Tagen allein mit Ski von der Antarktisküste bis zum Südpol. Gut 1380 Kilometer weit. Auch das war ein Rekord. Trainiert hatte sie zuvor unter anderem auf einer Durchquerung des grönländischen Inlandeises. Und zu Hause am Zürichsee, wo sie Autoreifen hinter sich herzog. Zur Verblüffung der Spaziergänger.
Stoff für Heldengeschichten, eigentlich. Anja Blacha erzählt davon eher zurückhaltend. Sie drängt nicht in die Öffentlichkeit, geht mit den Erfolgen nicht hausieren, verbrämt und beschönigt nichts – alles andere als selbstverständlich in einer Social-Media-geprägten Zeit, in der schon eine Besteigung des Watzmanns als episches Extremabenteuer verbreitet wird. Sie spricht auch offen darüber, wer sie wie bei ihren Erfolgen unterstützt hat. Auch das halten viele Bergsteiger heute anders, gerade am Everest.
Ihr Gipfelvideo dort, das sie allein ganz oben zeigt und auf Instagram zu sehen ist, sei ein bisschen irreführend, sagt Anja Blacha, deshalb sei es ihr wichtig gewesen, besonders Mingma G auch öffentlich zu danken, dem Leiter des Expeditionsveranstalters Imagine Nepal, mit dem sie am Everest unterwegs war. Er habe ihr kurzfristig ein Permit organisiert, das Basislager und Lager 2 nur für sie länger offen gehalten, ihr Hinweise gegeben, wo sie am Berg in welchem Lager Gasvorräte oder einen Schlafsack finden könne. „Er hat immer vorausgedacht, er war ständig auf Standby. Das habe ich an anderen Bergen und mit anderen Veranstaltern noch nie so erlebt.“
„Ich darf vor allem nicht an meine Grenzen gehen“
In diesem Jahr hat sie nun Annapurna, Dhaulagiri (8167 Meter) und Mount Everest bestiegen, im vergangenen Jahr waren es vier Achttausender, 2023 weitere drei – ein gewaltiges Programm. Wie schafft sie das? „Ich darf vor allem nicht an meine Grenzen gehen“, sagt Anja Blacha. „Wenn ich bei der Ankunft noch Reserven habe, kann ich schneller regenerieren, als wenn der Körper platt ist und keine Kraft mehr hat, sich wieder aufzubauen. Und wenn ich keine Reserven mehr habe, habe ich auch unterwegs ein Problem. Es kann ja immer etwas passieren, ein Sérac bricht ab, die Route ist unterbrochen, ein anderer Bergsteiger verunglückt.“ Ihr eigenes Tempo halten, auch mal einen halben Schritt langsamer gehen, das helfe ihr, den Körper nicht zu überfordern, immer im grünen Bereich zu bleiben.
Einmal hat sie diesen Bereich auch schon überschritten. Das war 2019 am Broad Peak (8051 Meter). Da wäre sie auf der Gipfeletappe umgedreht, hätte ein Sherpa, mit dem ihr Team unterwegs war, sie nicht überzeugt weiterzugehen. „Im Abstieg wäre es dann ohne Mingma nicht mehr gut gewesen für mich.“ Mit ihm schaffte sie es. Aber: „Da war ich über der Grenze der Eigenverantwortung, da habe ich meine Verantwortung in seine Hände gegeben. Das habe ich seitdem nie wieder gemacht.“ Man müsse auf sich selbst hören in grenzwertigen Situationen, dürfe das eigene Verhalten nicht an jenem anderer Bergsteiger ausrichten. „Im Endeffekt ist es das Bauchgefühl, das entscheidet, die Intuition, die sich aus den eigenen Erfahrungen speist.“
„Ich hab nur noch gedacht: So will ich nicht sterben“
Dem Tod begegnet ist sie trotzdem schon, nicht nur wegen der Leichen am Everest. 2023 am Nanga Parbat (8126 Meter) half sie zunächst, einen höhenkranken Bergsteiger nach unten zu bringen, der später trotzdem im Lager 4 starb. Im vergangenen April, beim Aufstieg auf die Annapurna, geriet sie zwischen Lager 2 und Lager 3 selbst in eine Lawine. Sie hörte zwei Bergsteiger hinter sich schreien, drehte sich um, sah sie weglaufen, da wurde sie schon von Schnee und Eis getroffen. Sie drückte sich gegen die Eiswand, machte sich am Seil fest, hob die Hände über den Kopf. „Es prasselte auf mich runter, und ich habe nur noch gedacht: So will ich nicht sterben.“
Irgendwann hörten die Einschläge auf. „Ich hatte kein Zeitgefühl mehr, ich kann nicht sagen, ob das ein paar Sekunden waren oder ein paar Minuten.“ Ihr Helm war zerbrochen, sie selbst blieb unverletzt. Sie fragte über Funk, ob auch die anderen Bergsteiger okay waren, und setzte dann ihren Aufstieg fort – „ich wollte nur noch raus aus dieser Zone“. Umzudrehen war keine Option. „Man weiß das vorher an der Annapurna, es ist der gefährlichste Achttausender, wegen des extremen Lawinenrisikos“, sagt Anja Blacha. „Jetzt abzusteigen, hätte nur bedeutet, dass ich noch einmal durch diese Zone muss.“ Am Gipfeltag bekam sie dann die Nachricht, dass am gleichen Tag eine weitere Lawine abgegangen war. Sie riss zwei Bergsteiger, Ngima Tashi Sherpa und Rima Rinje Sherpa, die für einen Expeditionsanbieter Sauerstoffflaschen für die Gipfeletappe transportierten, in den Tod.
Ihre Familie vertraut ihr
Wie reagiert ihre Familie auf solche Erlebnisse? Deren Sorge sei vor allem bei der Solo-Expedition in der Antarktis groß gewesen, sagt Anja Blacha. „Erst als sie gesehen haben, wie viel Planung und Sicherheitsdenken da reingehen, haben sie sich damit angefreundet und mich unterstützt.“ Die Familie ist nicht in der Bergszene zu Hause, was Vor- und Nachteile haben kann. „Sie versuchen, mir nicht im Wege zu stehen, sie wollen, dass das Vertrauen in mich im Vordergrund steht.“ Darin, dass sie keine kopflose Draufgängerin ist, dass sie absteigt, wenn das nötig ist, wie sie es auch schon getan hat: am Mount Everest, am K2, am Kangchendzönga.
Alle 14 Achttausender hat bisher nur ein einziger Deutscher bestiegen, Ralf Dujmovits. Anja Blacha fehlen nun noch zwei Gipfel, der Lhotse (8516 Meter) und die Shishapangma (8027 Meter). Wann sie dort einen Anlauf nehmen kann, ist noch unklar. Sicher ist nur: Loslassen werden die Berge sie nun so schnell wohl nicht mehr.