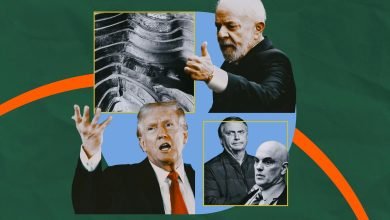Am Unteren Odertal im Vorland Stettins | ABC-Z

Der Sommerwind, wild und warm, braust durch die Apfelbäume. Aus den Gesichtern von Benedikt und Elwira Brußk spricht genau solch eine fröhliche Kraft, die sich voll Zuversicht ins Leben stürzt. Die beiden, noch keine vierzig Jahre alt, sind ein deutsch-polnisches Ehepaar und leben mit ihren zwei Töchtern in Geesow, unweit von Tantow, dem letzten deutschen Bahnhalt vor der polnischen Grenze auf dem Weg nach Stettin. Hier, im vormals pommerschen, heute brandenburgischen Teil der Uckermark, ist das Land weit. Hier hört man auf manchen Dörfern den Kuckuck noch im Juli und die Kraniche beim Schlafengehen in den Gerstenfeldern. Hier kann man, mit etwas Glück, Schwarzstörche im Unteren Odertal sichten. Hier erzählen die Anwohner, wie nachts der Uhu durch die Luft streicht oder der junge Biber, auf der Suche nach einem eigenen Revier, am Hoftor rüttelt. Manchmal holt sich der Fuchs ein Huhn.
„Niemand hat an uns geglaubt. Auch die Familie nicht“, sagt Elwira Brußk. Sie stammt aus Masuren, aus einem kleinen Dorf „zwischen Rastenburg und Allenstein“, wie sie die polnischen Orte Kętrzyn und Olsztyn ganz selbstverständlich nennt. Gleich nach der Schule kam sie für ein freiwilliges soziales Jahr nach Deutschland. Im Kloster Panschwitz-Kuckau, in Sachsen, lernte sie vor 19 Jahren Benedikt Brußk kennen. Er ist Sorbe und wie Elwira katholisch. Damals leistete er seinen Zivildienst ab und arbeitete mit behinderten Erwachsenen, während sich Elwira mit Kindern beschäftigte. „Wir sahen uns nur im Speisesaal beim Mittagessen“, erinnert sie sich, „und waren beide ganz zurückhaltend, weil wir Angst hatten, uns nicht richtig verständlich machen zu können. Aber er war immer so hilfsbereit und nett. Es hat sechs Monate gedauert, bis es zwischen uns gefunkt hat.“
Elwira ging zurück zum Studium nach Polen, Benedikt blieb in Deutschland. Beide studierten, um Erzieher zu werden. Zweimal in drei Jahren besuchte er sie im einstigen Ostpreußen, aber viel öfter trafen sie sich genau in der Mitte, in Posen, bei Elwiras Tante. Einer lernte die Sprache des anderen; beide wollten ihr Leben miteinander teilen. Aber wie? Und wo?
„Elwira hat immer gesagt, wenn sie schon so weit weg von ihrer Heimat leben muss, will sie wenigstens direkt an der Grenze wohnen, falls wir irgendwann einmal zusammenziehen sollten“, erzählt Benedikt Brußk. „Dann bin ich auf der Landkarte mit dem Finger die Grenze entlanggefahren und habe, weil ich gerade mit der Ausbildung fertig war, nach einer Arbeitsstelle gesucht. So stieß ich auf Tantow. Von dort ist es nicht weit nach Stettin. Elwira war es wichtig, mit der Bahn direkt zu ihren Eltern fahren zu können. Das geht von Stettin aus ganz gut. In Tantow, an der evangelischen Vorschule war eine Stelle frei. Auf die habe ich mich beworben. Das war das einzige Vorstellungsgespräch meines Lebens. Sie haben mich mit Kusshand genommen.“

Vor 15 Jahren zogen die beiden nach Radekow, nördlich von Tantow, in eine Mietwohnung. Sie schwärmen noch heute von der Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft, mit der sie dort aufgenommen wurden. Es gab keinerlei Feindschaft, keinerlei Misstrauen gegen die Neuen. In der Kirche von Przecław, einem polnischen Dorf vor Stettin, fand die deutsch-polnische Trauung statt: Beide Familien reisten an; Benedikts Bruder spielte die Orgel; Benedikts Mutter, Tanten und Großmütter trugen sorbische Tracht. Die einheimischen Polen staunten. Sie hatten so etwas noch nie gesehen, kamen in die Kirche und erlebten die Trauung mit.
Später zog das Ehepaar nach Geesow in ein großes Einfamilienhaus auf einem Grundstück von 1700 Quadratmetern. „Hier können meine Kinder so frei aufwachsen, wie ich aufwuchs“, sagt Benedikt Brußk. Inzwischen arbeiten er und seine Frau in derselben Kindertagesstätte und dem Grundschulhort in Casekow als Erzieher. Auch wenn das Leben hier nicht einfach ist, weil die größere Tochter Amelia eine Stunde per Bus zum Gymnasium nach Schwedt fahren muss und keine Klavierlehrerin an der dortigen Musikschule bekommt; auch wenn dringend etwas für Kinder und Jugendliche, für den Zustand der Schulen und Kindergärten, für Klubs getan werden müsste; auch wenn jede Freizeitaktivität der Kinder mit Autofahrerei verbunden ist, weil weder die Bus- noch die Bahnverbindungen dicht genug sind, so lieben sie doch ihr Zuhause. „Es stand nie die Frage im Raum, woanders hinzugehen“, sagt Benedikt Brußk. „Wir haben hier Arbeit, können zusammen sein – und gut! Wir sind hier einfach glücklich. Was soll denn besser sein in Hamburg? Oder in Berlin?“

Dorota Budzińska sieht das ganz ähnlich. Sie ist Unternehmerin aus Greifenhagen, dem heute polnischen Gryfino, lebt aber seit 14 Jahren in Radekow auf der deutschen Seite der Grenze. Dort hat sie sich ein Haus mit Garten gekauft und saniert, weil die Grundstückspreise damals oft nur ein Zehntel von dem betrugen, was man im Umland der boomenden Großstadt Stettin gezahlt hätte. Jetzt betreibt sie von Deutschland aus ihren Kunststoffhandel mit Kunden in ganz Polen.
„Es war überhaupt nicht schwer, hier Fuß zu fassen. Mir ist auch kein Misstrauen begegnet. Das hat wohl damit zu tun, dass hier nicht nur Alteingesessene wohnen“, erinnert sich Budzińska. „Viele der Eltern und Großeltern der jungen Leute hier waren Neuankömmlinge gewesen, Flüchtlinge und Vertriebene aus Schlesien oder Hinterpommern. In Radekow war ich nicht die erste Polin. Auch meine Nachbarin ist Spätaussiedlerin und spricht noch Polnisch. Ich fühle mich wohl hier und möchte hier bleiben.“

Jeden Tag läuft sie zehn Kilometer durch Felder und Wälder: morgens vier, abends sechs. Sie liebt, wie die zahlreichen Fahrradtouristen, die Ruhe hier, die geringe Verkehrsdichte – und den Kontrast zur brummenden Großstadt Stettin, die mit ihren 400.000 Einwohnern nur 15 Autominuten entfernt liegt.
Stettin – heute Szczecin – war bis 1945 siebenhundert Jahre lang das Zentrum der Region: Hauptresidenz der Herzöge von Pommern, später Behördensitz des Regierungsbezirks Stettin im Deutschen Reich und Hauptstadt der nunmehr preußischen Provinz Pommern. Stettin war zugleich Berlins Zugang zur Ostsee. Fast alle Transporte im Seehandel und Passagierverkehr gingen von Berlin aus nach Stettin und umgekehrt. Das prächtige Terrassen-Entree an der Oder mit seinen schlossartigen Aufbauten im Jugendstil und der Neo-Renaissance, das der Oberbürgermeister Hermann Haken an der Wende zum 20. Jahrhundert anlegen ließ, ist nicht nur das städtebauliche Festfoyer der mächtigen Industrie- und Handelsstadt Stettin gewesen, sondern zugleich die vorgezogene Eingangshalle für Berlin.

Man fuhr mit der Eisenbahn nach Stettin und stieg dort auf den Dampfer um, oderabwärts Richtung Swinemünde an der Pommerschen Bucht. Schon am 15. August 1843 nahm die Eisenbahnlinie Berlin–Stettin den Betrieb auf, zunächst eingleisig, ab dem 1. August 1873 zweigleisig. Die Seeanbindung der deutschen Hauptstadt war so wichtig, dass die Bahnlinie von Berlin nach Stettin sich zur modernsten im Deutschen Reich entwickelte. Am 8. August 1924 war sie vollelektrifiziert und damit das Modell für die Berliner S-Bahn.
Und heute? Fährt kein Zug. Das zweite Gleis ging nach Kriegsende 1945 als Reparationsleistung an die Sowjetunion. Zwischen Angermünde und Stettin können nur Dieselloks fahren, aber weil nun schon seit Jahren angeblich das zweite Gleis verlegt und die Strecke wieder elektrifiziert werden soll, wovon freilich nichts zu sehen ist, fährt man derzeit von Angermünde nach Stettin mehr als anderthalb Stunden mit dem Schienenersatzbus. Die Gegend ist infrastrukturell in radikaler Weise abgekoppelt. Die Abtrennung Stettins vom deutschen Teil Vorpommerns hat nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Verödung auf beiden Seiten geführt. Die landwirtschaftlichen Betriebe auf den Dörfern, die Pommersche Obst- und Gehölzschule Radekow, 1840 von August Friedrich Schmidt, einem Bekannten des preußischen Gartengestalters Peter Joseph Lenné, gegründet, verloren ihren Sinn.

Auch aus Warschauer Perspektive wurde Stettin vernachlässigt. Es war 700 Jahre lang kein Teil Polens gewesen. Die Folgen spüre man bis heute, sagt Jacek Jekiel, seit 2013 Direktor der Opera na zamku, der Stettiner Schlossoper in der ehemaligen Residenz der pommerschen Herzöge. Von den 14 Opernhäusern Polens werde die Hälfte von der Warschauer Zentralregierung finanziert. Stettin gehöre nicht dazu. Alles, was in Stettin an Neuem entstanden sei, die 2014 eröffnete futuristische Philharmonie, die sanierte Oper, viele Infrastrukturmaßnahmen, haben die Stadt und die Woiwodschaft Westpommern gemeinsam mit großzügigen Fördermitteln der Europäischen Union gestemmt. Unter der PiS-Regierung habe sich diese Vernachlässigung Stettins noch einmal verschärft, ist zu hören. Kaum jemand ist im Kulturleben Stettins gut zu sprechen auf die Nationalkonservativen. Der liberale Präsidentschaftskandidat Rafał Trzaskowski kam in und um Stettin bei den Wahlen 2025 auf Stimmenanteile zwischen siebzig und neunzig Prozent.

„Wir sind hier in Stettin weltoffen“, sagt Jekiel, „unsere Hoffnung ist Europa.“ Die Via Teatri ist ein grenzübergreifender Bühnenverbund, der nun in die zweite Saison geht. Von 2017 bis 2022 kooperierte die Stettiner Schlossoper mit dem Theater Vorpommern und den Uckermärkischen Bühnen Schwedt, seither mit den Theatern Anklam und Schwedt. Die EU fördert Übertitelungsanlagen in deutscher und polnischer Sprache. „Wir haben zehn Prozent deutsche Gäste“, sagt Jekiel.

Die Oper hat einen modernen Saal mit 520 Sitzplätzen im restaurierten, vormals kriegszerstörten Schloss, einen Orchestergraben für etwa 50 Musiker, eine Drehbühne und mehr als 40 Bühnenzüge. Mit einem Jahresetat von 20 Millionen Złoty (etwa 4,8 Millionen Euro) werden ein Chor von 30 Leuten, ein Ensemble von zwölf Solisten und ein Orchester finanziert, dazu jährliche Neuproduktionen. Mit Benjamin Brittens „The Turn of the Screw“ gewann man 2017 den Titel „Opernproduktion des Jahres“ in Polen, obwohl die Kritiker aus Warschau zehn Stunden mit dem Zug nach Stettin brauchten. Seit Dezember 2024 reist man deutlich schneller.
Trotz herzlicher Bekundungen von der deutschen Politik werden die Avancen der Woiwodschaft Westpommern, Stettin zur deutsch-polnischen Metropolregion auszubauen, nur zögerlich erwidert. Die Verschleppung des Ausbaus der Bahnlinie beweist es schmerzhaft. Hilmar Warnkross, seit 2006 evangelischer Pastor in Gartz an der Oder, sieht wie der 25 Jahre junge Gartzer Bürgermeister Luca Piwodda, der hier für eine enorme Aufbruchstimmung gesorgt hat, trotzdem Potential für diesen Landstrich: „Grundsätzlich sind hier, abgesehen von großstädtischen Lifestyle-Angeboten, alle Voraussetzungen erfüllt, um gut leben zu können. Natürlich muss das zweite Bahngleis fertig werden, dann kann man eine dicht getaktete Verbindung zwischen Berlin und Stettin laufen lassen. Man kann mit einem Hochgeschwindigkeitsinternet viel im Homeoffice erledigen. Die innere Sicherheit ist hier sehr hoch, das Angebot an Kindergarten- und Schulplätzen auch.“

Warnkross, der auch als Berater in der Lokalpolitik wirkt und soziologisch genauso gut beschlagen ist wie theologisch, meint: „Wir brauchen Leute, die nicht mit einer Konsumhaltung herkommen und zuerst fragen: ,Was wird mir hier geboten?‘ Sondern: ,Was ist mit Selbstwirksamkeit an einem Ort, an dem noch nicht viel getan wurde, zu erreichen?‘ Die Landschaft ist wunderschön. Hier ließe sich manches bauen, einiges investieren. Energie ist im Übermaß zu günstigen Preisen vorhanden. Das wäre ein echter Standortvorteil.“
Momentan weist das Lohn- und Rentengefälle von West nach Ost, weshalb die Arbeitsmigration nach Deutschland, nicht nach Polen erfolgt. Die Grundstückspreise sind aber im Westen niedriger als in Polen, was die Zuwanderung noch einmal befördert. „Vor dem Beitritt Polens zum Schengen-Raum sagten mir viele Leute, wenn sie einmal nicht mehr seien, würden die Häuser zugenagelt, weil hier keine Menschen mehr herkämen“, sagt Warnkross. „Der Zuzug aus Polen hat verhindert, dass dieser Landstrich ausstirbt. Mit der Grenzöffnung haben viele Polen Immobilien gekauft, um hier zu wohnen und in Polen zu arbeiten. Plötzlich gab es wieder Leute für die Freiwillige Feuerwehr, die Werkstätten, das Gesundheitswesen, den Pflegedienst, die Gastronomie. Ohne die Polen würde das alles nicht mehr funktionieren. Wenn man die Parole ,Deutschland den Deutschen, Ausländer raus‘ umsetzen würde, würden die Systeme hier kollabieren.“

Momentan erschweren Grenzkontrollen den Austausch. Nach den deutschen Kontrollen antwortet Polen jetzt mit Soldaten, die mit Maschinenpistolen bewaffnet das Land von Osten aus sichern. Aber das Verhältnis zwischen den Behörden ist grenzübergreifend solidarisch und kooperativ. Die politischen Machtverhältnisse in Warschau, nicht einmal die hohen Stimmenanteile für die AfD in der Uckermark und in Gartz scheinen auf das einvernehmliche Miteinander zwischen Polen und Deutschen, den „schönen Mischmasch“, wie Benedikt Brußk das nennt, ernstlichen Einfluss zu haben. Zwar zieht die deutsche Jugend noch immer weg aus der Region, zwar ist die Hälfte aller Gartzer älter als 65 Jahre, aber Dorota Budzińska ist überzeugt, die deutsche Jugend hätte mehr Chancen, wenn sie endlich Polnisch lernte und sich nach Stettin orientierte: „Wer was im Kopf hat und nicht unbedingt auf einem Amt arbeiten möchte, kann in Stettin anständig bezahlte Stellen finden.“
Doch so einfach ist es für Deutsche nicht, in Polen Fuß zu fassen. Warnkross berichtet von enttäuschten deutschen Unternehmern: „Zu den Behörden geht man dort nicht selber hin, stellt einen Antrag und lässt ihn bearbeiten. In Polen kennt man jemanden, der bei der Behörde jemanden kennt, der dafür sorgt, dass der Antrag auch bearbeitet wird. Es gibt in Polen sehr viel sozialen Kontext rund um die formalen Belange einer staatlichen Behörde, der als normal akzeptiert wird.“
Die deutsche Geschichte hingegen wird im Stettiner Raum wieder gepflegt, oft ganz überraschend. Wenn man vom Grenzübergang Linken aus auf der polnischen Seite weiter nach Norden fährt, stößt man vor der Kirche im Dörfchen Buk auf ein ganz neues Denkmal. Es zeigt die australische Schriftstellerin Mary Annette Beauchamp, besser bekannt als Gräfin Elizabeth von Arnim-Schlagenthin. Von 1896 bis 1908 lebte sie im Nachbardorf Rzędziny, dem damaligen Gut Nassenheide, wo sie die Schriftsteller Hugh Walpole und Edward Morgan Foster, den Autor des Romans „Zimmer mit Ausblick“, empfing und wie eine pommersche Jane Austen im Wilhelminismus ihre Romane schrieb. „Elizabeth and her German Garden“ war 1898 der erste darunter. Von Gut und Garten ist nichts mehr zu sehen. Aber als Statue reicht Elizabeth von Arnim dem Besucher heute einen üppigen Strauß Rosen.
Bisher erschienen: Das deutsch-französisch-schweizerische Dreiländereck (3. Juli); das deutsch-belgisch-luxemburgische Grenzland (10. Juli).