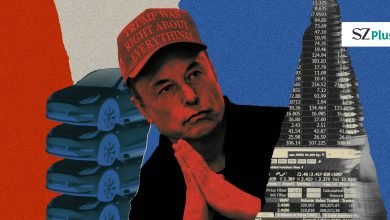Lena Schättes „Das Schwarz an den Händen meines Vaters“ | ABC-Z

Ein paarmal in Lena Schättes kurzem Roman hält die Zeit an. Und der Text irgendwie auch. Dann steht da ein Satz auf dem Papier und blinkt wie ein Blaulicht.
„Ich verliebe mich in einen trinkenden Mann, weil es wie zu Hause ist.“
„Kurz bevor ich ausziehe, als mein Bruder schon weg ist, verstehen mein Vater und ich uns nur noch, wenn wir beide getrunken haben.“
„Nachdem er gestorben ist, schäme ich mich, wenn ich schlecht von ihm denke. Ich bilde mir ein, dass er mich hört, jeden Gedanken. Und deshalb sage ich lieber Dinge laut wie Ich wünschte, du wärst hier statt Ich wünschte, wir wären andere gewesen.“
„Mein Bruder kippt den Schnaps ins Grab.“
„Ich sage ja, doch schüttle den Kopf.“
Lena Schättes „Das Schwarz an den Händen meines Vaters“ ist der Dorfroman eines weltumspannenden, generationenübergreifenden und soziale Schichten vereinenden Problems. Sucht. Ein Vater trinkt, die Mutter hält den Laden zusammen, die drei Kinder sind, je nach Alter, der Situation entwachsen (die älteste Tochter) oder ihr gewachsen (der Sohn) oder überfordert (die jüngste Tochter, die uns die Geschichte erzählt).
Die Zeit sind die Neunzigerjahre. Die Familie lebt im Sauerland, das ist die Heimat der Autorin und des künftigen Bundeskanzlers, der im Wahlkampf mit einem Lastwagen durch die Bundesrepublik gezogen ist, auf dem „Mehr Sauerland für Deutschland“ stand. Muss ja jeder selber wissen, wie man früher auf Twitter gesagt hätte. Es ist jedenfalls eine tiefkatholische Region, in der Frauen, wenn sie am Sonntagmorgen joggen gehen, von ihren Nachbarinnen zur Ordnung gerufen werden.
Die Menschen trinken überall
Lena Schätte lebt dort bis heute, bei unserem Gespräch zur Mittagszeit läuten die Kirchenglocken, und sie sagt: „Es war nicht einmal eine Sekunde in meinem Kopf, diese Geschichte irgendwo anders hinzusetzen als ins Sauerland.“ Aber sie erklärt dann auch sofort, dass ihre Geschichte überall spielen könnte. Denn die Menschen trinken überall. Auf dem Dorf. In der Stadt. Ob sie links oder rechts wählen oder gar nicht, katholisch sind oder gar nichts. Ort, Zeit und Handlung dieser Geschichte sind global übertragbar.
In Lena Schättes Roman trinken sie alle. Fast jedenfalls. Der Vater. Der erste und der zweite Mann der Großmutter. Der Pfarrer. Die Erzählerin selbst dann irgendwann auch. Sie nennt sich Motte, nein: Ihr Vater nennt sie Motte – und das ist die eine erkennbare Metapher in der ungekünstelten Prosa dieses Buchs, denn die Tochter umkreist den Vater, der ihr Lebenslicht ist und es zugleich für immer eintrüben wird, bis zum Schluss.
Der Ausdruck in den Augen der Vorfahren
Erst stirbt aber die Oma. Motte hatte ihr ein Fotoalbum geklaut, bevor die dement gewordene Frau es wegwerfen konnte. „Meine Vorfahren sehen ausgemergelt, erschöpft und betrunken aus“, erzählt sie. „Besonders mein Urgroßvater scheint selbst auf den Fotografien vom Kinderfest im Wildpark diesen Ausdruck in den Augen zu haben.“
Motte zeigt die Bilder der Schwester ihrer Oma, die im Pflegeheim lebt. „Das war früher doch ganz normal, sagt sie. Ich habe freitagnachmittags mit den anderen Frauen vor der Fabrik gestanden, und wir haben unsere Ehemänner abgefangen und ihnen die Lohntüten abgenommen, damit sie sie nicht in die Kneipe brachten. Sie lacht (. . .) Ich frage sie, ob sie nie getrunken hat. Nein, das ging nicht, schüttelt sie den Kopf. Ich hatte doch die Kinder und das Haus und die Arbeit in der Schneiderei, das wäre gar nicht gegangen.“
Hier spricht eine Romanfigur. Die Autorin, die sie sich ausgedacht hat und die seit ihrer Ausbildung im Suchthilfesystem arbeitet, zuletzt in einer Eingliederungshilfe für Menschen mit Suchterkrankungen in Lüdenscheid, sagt: Frauen trinken auch. Sie tun es vielleicht funktionaler, und sie tauchen nicht in gleichem Maße in dem Suchthilfesystem auf wie Männer, aber sie trinken.
Schnaps bedeutet Ärger
Mottes Mutter hält in diesem Roman jedoch die Verhältnisse zusammen, so gut es geht. Sie trinkt nicht. Aber, erzählt Motte, „meine Mutter bringt uns Töchtern Dinge bei. Andere Dinge, als mit geradem Rücken am Esstisch zu sitzen, als Danke und Bitte zu sagen, andere Dinge als ihrem Sohn. Sie bringt uns bei, dass Schnaps Ärger bedeutet.“ Dann folgt noch so ein Satz mit Blaulicht: „Und sie bringt uns bei, dass eine Frau immer Fluchtgeld haben muss.“

Wenn in diesem Bücherfrühjahr etwas auffällt, dann ist es die große Zahl der literarischen Neuerscheinungen unterschiedlicher Formate, die sich der Familie von heute widmen – abseits von Vater-Mutter-Kind, Doppelhaushälfte, im Carport ein Kombi mit Schattenkatze. Zu diesen literarischen Texten zählen Bettina Wilperts „Eine bärtige Frau“ (Verbrecher Verlag) wie Katharina Bendixens „Eine zeitgemäße Form der Liebe“ (Edition Nautilus), Kristine Bilkaus „Halbinsel“ (Luchterhand, auf der Shortlist des Leipziger Buchpreises) oder Sara Gmuers „Achtzehnter Stock“ (Hanser Blau). Es sind alles Bücher über angeknackste, beschädigte familiäre Konstellationen und über die Bedingungen, unter denen sich dennoch so etwas wie Glück oder Durchatmen ergeben können. Offenbar ist der Bedarf an diesen Geschichten akut groß geworden.
Lena Schättes neuer und zweiter Roman (nach „Ruhrpottliebe“ von 2014) passt da mitten hinein. Auch in dem Sinn, wie die Familie dieser Geschichte sich im Zerbrechen immer noch Halt gibt und daran nur noch mehr zerbricht. So ungekünstelt und klar die Prosa der Autorin ist, die für einen Auszug aus diesem Roman im vergangenen Jahr den W.G.-Sebald-Literaturpreis erhalten hat: Die Stärke ihres Textes liegt in der Ambivalenz. Das klingt nach Plattitüde, Ambivalenz sollte ja die Mindestforderung an einen literarischen Text sein.
Erschütternden Lakonie, fürchterliche Zwischenfälle
Aber gerade bei einem komplexen Thema wie Sucht ist die Simulation dieser Komplexität nicht so ohne Weiteres zu erreichen. Lena Schätte gelingt es aber, dass sich diese Ambivalenz nicht nur formal einstellt – in der erschütternden Lakonie, mit der sie die fürchterlichsten Zwischenfälle beschreibt –, sondern auch in den Affekten, die sie ihre Figuren durchleben lässt.
„Ich habe zu viele Texte gelesen, in denen Sucht oder generell psychiatrische Erkrankungen als Täter-Opfer-Geschichte erzählt werden“, sagt sie selbst, danach befragt. „Das ist unfair. Jeder Tag hat 24 Stunden. Man ist nicht immer nur besoffen, man ist nicht immer nur Scheiße, es ist alles gleichzeitig da, das Familienleben, die Liebe, das Vertrauen, aber auch der Bruch und die Enttäuschung.“
Motte liebt ihren Vater, aber sie lebt auch in der ständigen Bedrohung, was der als Nächstes tun könnte, um die Familie zu ruinieren, ohne es zu wollen. Einmal fährt er besoffen im Schnee mit dem Auto auf Sommerreifen den Berg hinunter direkt in die Dorfbäckerei, wir sind hier ja in den Steilhängen des Sauerlands. Die Motorhaube liegt tief in der Theke vergraben, die Eingangstür zertrümmert auf dem Autodach. In solchen Trümmern zu leben, hat die Familie da aber längst gelernt. Es ist das Geheimnis, dass die Frauen solcher Familien von einer Generation an die nächste weitergeben: wie das geht. Motte wünscht sich, sie wären andere gewesen. Und sie wünscht sich, der Vater wäre noch da, als er tot ist.

„Ich komme aus einer Arbeiterfamilie aus dem Sauerland mit einem Suchtthema“, erzählt Lena Schätte. „Und auch wenn das nicht mein Vater ist und nicht meine Geschichte, bringt es immer ein Maß an Verantwortung und Feingefühl mit. Alle um mich herum müssen die Geschichte, die ich erzähle, mittragen. Und auch deswegen war es klar, dass es Dinge gibt, die ausgelassen werden müssen.“ Was dieser Roman auch auslässt, aber trotzdem zur Sprache bringt, man kann diese Geschichte im Frühjahr 2025 gar nicht anders lesen: Das sind die sozialen Verhältnisse.
Kein Dorfkitsch wie bei Juli Zeh
„Das Schwarz an den Händen meines Vaters“ ist auch die Geschichte eines Arbeiters und seiner Kinder, der Vater schuftet in der Metallverarbeitung, montags werden seine Hände grau, „über die Woche immer dunkler. An Freitagen ist das Schwarz in jede Rille seiner Hornhaut gekrochen, das spröde Nagelbett tiefrot.“ Schätte psychologisiert nicht, erzwingt keinen Zusammenhang zwischen Fabrik und Schnaps. Sie betreibt auch keinen Dorfkitsch wie Juli Zeh und bringt die Weisheit der Provinz gegen die Arroganz elitärer Städter in Stellung. Sie lenkt einfach nur den Blick (wie vor Jahren Christian Baron in „Ein Mann seiner Klasse“) in ein Milieu hinein, auf das meist nur dann genauer geschaut wird, wenn es sich an Wahlabenden komisch entscheidet. Und wie sehr solche Geschichten fehlen, merkt man dann, wenn man nachzählt, an wie viele dieser Art aus der vergangenen Zeit man sich erinnern kann.
Motte nennt der Vater seine Tochter also – das ist, wie gesagt, die eine erkennbare Metapher dieses Romans. Die andere ist die Raststätte an der Autobahn, die Mottes Familie irgendwann zu betreiben beginnt. Alle helfen mit, die Mutter kocht, eine Zeit lang läuft es auch, trotz der Eskapaden des Vaters, aber dann öffnet drei Ausfahrten weiter eine größere Raststätte, die Kundschaft versiegt. Doch weil der Pächter nicht weiß, was er mit dem Haus sonst machen soll, überlässt er es der Familie.
Die Rastlosigkeit des Traumas
„Und so bleiben wir dort wohnen. Wir räumen die schweren Holztische aus dem Gastraum, schieben Wohnzimmermöbel hinein, nur ein paar Eckbänke bleiben. Meine Mutter kauft grünes Geschenkpapier mit roten Blumen und klebt ein Fenster ab, durch das Spaziergänger manchmal ins Innere spähen . . . Mein Vater geht morgens auf die Gästetoilette und putzt sich dort die Zähne, verteilt seine Zeitschriften in den Kabinen. Wir lassen das Fett aus den Fritteusen, trinken weiter Kaffee aus dem schnörkellosen weißen Porzellan.“
Die Familie zieht in die Kulissen einer Gemütlichkeit, die für fremde Menschen auf der Durchreise eingerichtet wurde, Fremde, die sich dort aber auch nur kurz wohlfühlten, wenn überhaupt. Raststätten, Brücken, Autobahnen, Übergangsorte, Provisorien: Chiffren für die Heimatlosigkeit, die ein Trauma mit sich bringt, für die Unruhe, die Rastlosigkeit.
Eine Zeit lang halten die Autos noch, und die Gäste versuchen, durch die verklebten Fenster in den Gastraum zu schauen, wo die Familie Fotos von Frankreichurlauben verteilt hat, an die sich niemand mehr erinnert, wo Christbaumkugeln am stillgelegten Zapfhahn hängen und der Schimmel die Wände hochklettert. „Und irgendwann haben alle verstanden, dass es uns nicht mehr gibt.“ Noch so ein Satz mit Blaulicht.
Lena Schätte, „Das Schwarz an den Händen meines Vaters.“ Roman. Verlag S. Fischer, 192 Seiten, 24 Euro.