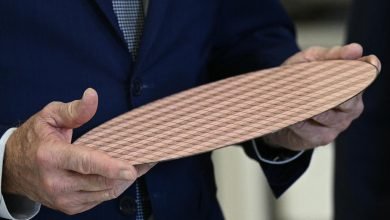Der Wert eines Menschen ist keine Frage des ökonomischen Nutzens – Wirtschaft | ABC-Z

Es dauerte nur ein paar Stunden. Noch wusste niemand, wo sich der gestürzte syrische Diktator Baschar al-Assad überhaupt aufhielt, da forderten die Ersten hierzulande schon schnelle Abschiebungen nach Syrien. Und ebenso schnell waren die sicherlich gut gemeinten Gegenargumente gefunden: Man kann die doch nicht einfach abschieben, schaut doch mal, wie wichtig sie für unsere Wirtschaft sind.
Dabei ist der Gedanke, der im Kern dieses Gegenarguments steckt kaum weniger herabwürdigend als der Rassismus hinter den Abschiebe-Forderungen. Es wird nur das eine Kriterium für die Bewertung eines Menschen – seine Herkunft – durch ein anderes ersetzt: seine wirtschaftliche Verwertbarkeit. Aber während offene Fremdenfeindlichkeit zurecht beim Großteil der Gesellschaft auf Ablehnung stößt, ist die ökonomische Logik weitverbreitet.
So drehte sich die deutsche Debatte auch im Zuge des Krieges in der Ukraine schnell um die Frage, was wichtiger sei: dass ukrainische Fachkräfte den hiesigen Betrieben helfen oder dass sie als Soldaten daheim die europäische Freiheit verteidigen. Dabei müsste doch genügen, dass sie erst einmal eines sind: Kriegsflüchtlinge.
Natürlich, die deutsche Wirtschaft war und ist abhängig von Arbeitskräften aus dem Ausland. Waren es früher die Gastarbeiter in der Schwerindustrie, sind es heute die Saisonarbeiter auf den Feldern, die 24-Stunden-Kräfte in der Pflege oder die Monteure auf dem Bau. Und betrachtet man den Fachkräftemangel und die demografische Entwicklung, ist klar, dass das noch lange so bleiben wird.
Und klar, Integration kostet: Zeit, Geld und Arbeitskraft. Es braucht Lehrerinnen, Sozialarbeiter, Beamte, die alle auch bezahlt werden wollen. Die Menschen aufzufordern, sich möglichst schnell am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben zu beteiligen, ist deshalb nicht falsch. Aber es kann nicht das Kriterium dafür sein, ob sie Hilfe bekommen oder nicht.
Doch nicht nur in der Integrations- und Migrationsdebatte steckt diese Ver- und Abwertungslogik. Sie steht im Zentrum vieler Sozialdebatten unserer Zeit – etwa, wenn es um die Forderungen nach Bürgergeldkürzungen für Langzeitarbeitslose geht. Aber verdienen ein menschenwürdiges Leben nur jene, die sich auch der Wirtschaft zur Verfügung stellen?
Genau dieser Nützlichkeitsgedanke spielt auch in der Diskriminierung von mit Menschen mit Behinderung eine zentrale Rolle. Die könnten nicht so produktiv arbeiten wie Nicht-Behinderte und seien dabei sogar noch, Gott bewahre, eine Belastung für das Gesundheitssystem, heißt es. Auf dieser Basis wird dann auch gegen von Kritikern seit Jahren vorgebrachte Mindestlohnforderungen in Behindertenwerkstätten argumentiert. Man biete doch das Gefühl, zumindest irgendwie nützlich zu sein – dann sollten die Betroffenen sich auch mit einem Entgelt von durchschnittlich 220 Euro im Monat zufriedengeben! Das Ganze müsse für die Werkstattbetreiber ja auch wirtschaftlich tragbar sein. Dass eine normale Teilhabe am gesellschaftlichen Geschehen unter solchen Bedingungen praktisch unmöglich ist, ist eigentlich offensichtlich, da reicht der Blick auf die Preisschilder im Supermarkt. Aber mit dem Argument des vermeintlich geringeren ökonomischen Nutzen wird auch hier der Wert des Menschen und seiner Arbeit geringgeschätzt. Auch wenn der integrative Grundgedanke hinter den Werkstätten, die Einbindung von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsalltag, ein löblicher ist, sorgt seine praktische Ausformung für das, was er eigentlich bekämpfen möchte: eine Herabwürdigung von Menschen.
Gerade in Deutschland, das sich der humanistischen Wurzeln seines Wertesystems rühmt, ist das der falsche Ansatz. Der Wert eines Menschenlebens kann nicht relativiert werden, er kann nicht zur Diskussion stehen, egal, wie die Begleitumstände dieses Lebens aussehen mögen: Herkunft und Gesundheitszustand können keine Parameter der Bewertung sein – und auch nicht die ökonomische Verwertbarkeit.