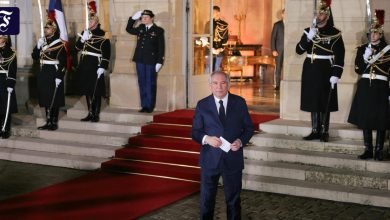Trump-Shops in Arizona: Fanartikel für echte Trumpisten | ABC-Z

Man muss den „Trumped Store“ in Show Low nicht betreten, um zu sehen, wem der Inhaber bei der Wahl im November die Daumen drückt. Vor dem Eingang flattern Trump-Fahnen einträchtig mit amerikanischen und israelischen Flaggen im Wind. Die großen Fenster sind ausgefüllt von Trump-Plakaten aus dem Jahr 2016. An den Wänden hängt ein Banner, das fordert, man müsse „Trumps Amerika“ zurückerobern. Eine Leuchtreklame fordert unter dem Namen Trump dazu auf, sich „dem Widerstand“ anzuschließen – „Join The Resistance“.
Wer den Laden betritt, wird von einem Pappaufsteller empfangen. Da steht Rambo mit AK-47 im Anschlag. Doch anstatt des Gesichts von Sylvester Stallone sitzt der Kopf von Donald Trump auf dem muskulösen Hals. Von links lächelt Steve Bannon – der frühere Chefstratege von Donald Trump – von einem Poster. „Lächle, es ist Rino-Jagdsaison“, verkündet er. Damit sind mitnichten die grauen Vierbeiner aus der afrikanischen Savanne gemeint, sondern Republikaner, die nicht auf der Trump-Linie liegen, solche, die angeblich nur dem Namen nach Republikaner sind („Republicans In Name Only“). Nach rechts öffnet sich die Verkaufsfläche. Es gibt alles, was das Herz eines Trump-Fans höher schlagen lässt: Tassen, Magnete, T-Shirts, Mützen, Flaggen, Aufkleber, Postkarten und vieles mehr. Ein Paradies für Trump-Anhänger.
Keine Verbindung zur Wahlkampagne
Hinter dem Kassentresen sitzt der Mann, der den Laden betreibt. Von seiner Brust blickt grimmig der frühere Präsident. „Ich wähle den verurteilten Straftäter“, steht auf dem schwarzen T-Shirt mit dem Trump-Konterfei vor der amerikanischen Flagge.
Steve Slaton selbst ist alles andere als grimmig. Wenn man ihn anspricht, schaut er aus wachen Augen unter seinen kurzen grauen Haaren auf, heißt im Laden willkommen und zeigt erst einmal seine neueste Ware: Fliesen. Darauf ist das Bild, das nach den Schüssen auf Trump in Pennsylvania um die Welt ging. Trump, Blut im Gesicht, reckt die Faust in den Himmel, über ihm weht die amerikanische Flagge, und drei Personenschützer des Secret Service versuchen, ihn in Sicherheit zu bringen. 20 Dollar kostet eine Fliese. Schon am Tag nach dem Attentat habe er Produkte mit diesem Bild besorgen müssen, erzählt er. Die Kunden hätten das verlangt.

Der 70 Jahre alte Slaton betreibt den Laden gemeinsam mit seiner Frau seit acht Jahren. Anfangs sei es das Hauptquartier der Trump-Kampagne in Show Low gewesen, sagt Slaton, und daraus habe sich dann der „Trumped Store“ entwickelt, der aber keine Verbindung zu Trump oder dessen Kampagne hat. Der Shop ist trotzdem mehr als nur ein Verkaufsladen, es ist auch ein Ort, um mit Gleichgesinnten zusammenzukommen und sich auszutauschen – eine Art republikanische Informationsbörse.
Für Trump-Anhänger mag der Laden ein Paradies sein, aber er zieht auch Gegner an. Vor ein paar Jahren habe die Antifa den Shop angreifen wollen, sagte Slaton. Er sei jedoch gewarnt worden. Er habe die „lokale Miliz – also eigentlich keine Miliz, sondern nur gute Bürger“ zusammengerufen. Acht Nächte lang hätten 15 teilweise mit Sturmgewehren bewaffnete Männer vor dem Laden gewacht. Passiert sei deshalb nichts.

Er und seine Frau seien aus der Tea-Party-Bewegung zu Trump gestoßen, erzählt Slaton. Die war 2009 eine Reaktion auf die als zu ausgabenfreudig betrachtete Wirtschaftspolitik von Barack Obama. Anfangs war sie vor allem libertär, driftete dann jedoch in den Rechtspopulismus ab. Von dort war es nicht mehr weit zu Trumps Make-America-Great-Again-Bewegung.
Slaton sieht in Amerika viele Probleme. Er klagt über die seiner Meinung nach offene Grenze zu Mexiko. Kamala Harris habe als Grenzbeauftragte – ein Titel und eine Aufgabe, welche die Vizepräsidentin in Wahrheit nie hatte – dafür gesorgt, dass viele illegale Einwanderer ins Land gekommen seien. Jetzt gebe es mehr Vergewaltigungen, mehr Kinderpornographie und mehr Drogen im Land. Auch er habe schon illegale Einwanderer in Show Low gesehen und die Polizei gerufen. Deshalb müsse die Grenze geschlossen werden, sagt Slaton.

Das andere große Problem sei die Inflation. Alles sei teurer geworden: Miete, Essen, Benzin. Das merke er auch in seinem Laden. Die Leute kämen zwar noch zu ihm, doch gäben sie weniger Geld aus als früher. Trump werde das alles besser machen, ist er überzeugt.
Für dessen MAGA-Bewegung wollte Slaton ins Repräsentantenhaus in Phoenix einziehen. Geklappt hat das nicht. In der Vorwahl der Republikaner wurde er von einem ortsansässigen Gegenkandidaten geschlagen. „Wir haben uns einen ganz schönen Kampf geliefert“, erzählt Slaton. Obwohl er sich locker gibt, scheint die Niederlage an ihm zu nagen. Vielleicht liegt es daran, dass er gegen einen Mormonen verloren hat. „Das ist keine Kirche, sondern eine Sekte“, erzählt er. In seinem Wahlbezirk gebe es viele davon, und die hassten Trump, gibt er sich sicher. „Wahrscheinlich gehen die im November gar nicht zur Wahl.“ Ihm reicht es nun aber: „Das hat mich anderthalb Jahre und eine Menge Geld gekostet. Das sollen jetzt Jüngere machen.“

Slaton versuchte, sich auch anderweitig zu engagieren. Nach der Präsidentenwahl 2020 habe er das Ergebnis überprüfen wollen, erzählt er. Er habe Freiwillige angeworben und nach den Vorgaben des Staats ausbilden lassen. Sodann habe er sich Wahlzettel kommen und die von den Freiwilligen durchschauen lassen. Zehn Prozent der Wahlzettel seien fehlerhaft gewesen. Vor allem hätten die Unterschriften auf den Zetteln nicht mit jenen im Wählerverzeichnis übereingestimmt. „Trump hätte einen Erdrutschsieg errungen“, sagt Slaton. Die Wahl sei gestohlen worden, wiederholt er die auch von Trump ohne Belege verbreitete Verschwörungserzählung. Sie seien mit ihren Ergebnisse auch vor Gericht gezogen, da aber abgeblitzt. „Die Gerichte wollen irgendwie nichts mit den Wahlen zu tun haben“, seufzt er. Tatsächlich haben amerikanische Gerichte Hunderte von Trump-Anhängern angestrengte Verfahren abgewiesen. Einige aus formalen Gründen, die meisten aber aus Mangel an Beweisen.
Show Low und die Umgebung ist Trump-Land. Vor vier Jahren lag der frühere Präsident hier 54 Prozentpunkte vor seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Der Ort mit rund 11.000 Einwohnern liegt am südlichen Ende des Navajo County. Dort war das Wahlergebnis wesentlich enger. Trump hatte nur einen Vorsprung von 8,3 Prozentpunkten. Deshalb sei der Wahlausgang dieses Jahr gegen Kamala Harris auch nicht ausgemacht, sagt Slaton. Er hoffe, sagt er, dass es nicht zu Gewalt komme, nach der Wahl. „Es sei denn, die Wahl wird wieder gestohlen. Dann ist alles möglich.“
„Die Demokraten wollen uns alle überwachen“
Rund 280 Kilometer südlich von Show Low ruft Robert Scott ein fröhliches Hallo, bevor er sich wieder seinem Smartphone widmet. Auch er ist umgeben von Trump-Shirts, Fahnen, Mützen, Aufklebern und vielem mehr. Doch während Steve Slatons Shop von außen auch wirkt wie ein Einkaufsladen, sieht es hier wie ein Haus aus, das man aus Westernfilmen kennt: helle Farben und eine hölzerne Veranda vor dem Haus. Fast erwartet man, einen Mann mit breitkrempigem Hut, staubigen Klamotten und klimpernden Sporen an den Cowboystiefeln aus der Tür kommen zu sehen. Doch das Schild über dem Eingang zeigt, dass das hier nicht der Wilde Westen ist. „Trump Store – Tombstone, Az“ steht da.

Tombstone ist der Ort einer amerikanischen Legende. 1881 kam es hier zu einer Auseinandersetzung zwischen Wyatt Earp und seinen Brüdern auf der einen und ein paar Cowboys auf der anderen Seite. Drei Cowboys starben im Kugelhagel. Namensgebend wurde ein Mietstall unweit des eigentlichen Tatorts, und so wurde es „Die Schießerei am O.K Corral“. Sie wurde als Symbol des Kampfes zwischen Recht und Ordnung und Gesetzlosigkeit im Wilden Westen in zahlreichen Büchern und Filmen unsterblich. Noch heute knallen dort die Revolver, wenn der Kampf für Touristen nachgestellt wird.
Auch der Laden etwas außerhalb des Ortes zollt seinem Standort Tribut. Auf dem Schild über dem Eingang ist nicht etwa ein normales Foto von Donald Trump, sondern er wird mit großem schwarzen Hut und Schrotflinte dargestellt. Sein Mund ist weit aufgerissen, als würde er einen Kampfschrei ausstoßen. Seinem Standort verdankt der Laden wahrscheinlich auch seine Kundschaft, denn ohne die Touristenattraktion würde sich wohl kaum jemand mitten in die Wüste 40 Kilometer nördlich der mexikanischen Grenze verirren.

Doch so, erzählt Robert Scott, kommen seine Kunden aus der ganzen Welt: „Einige sind echte Trump-Fans.“ Das auch Scott dazu zählt, zeigt seine rote „America First“-Mütze. Um seinen Mund zieht sich ein grauer Bart, aus beigen Shorts ragen die Beine hervor. Er trägt ein schwarzes T-Shirt mit einem Bild von George Washington und einem Ausspruch, den der erste Präsident der Vereinigten Staaten mit Sicherheit nie getätigt hat: „Ich und meine Kumpels hätten schon lange angefangen, Leute umzubringen“ („Me and my homies woulda been stacking bodies by now“).
Dabei ist Scott eigentlich ganz umgänglich, erzählt ruhig, aber mit Überzeugung. Zum Beispiel, dass er früher liberal war und Trump nicht leiden konnte. Für ihn war das ein abgehobener Milliardär aus New York. Irgendwann habe er aber auf Youtube ein Video gesehen, das ihm die Augen geöffnet habe. Es ging um den Vergleich zwischen den Bildern, welche die Fernsehsender von Trump zeigten, und den wirklichen Bildern. Da habe er erkannt, dass er manipuliert werden soll. Er sagt, er sei erwacht und habe sich „vom Hass freigemacht“.

Was er jetzt – vor allem in den sozialen Medien – sieht, gefällt ihm nicht. Die Demokraten und Liberale wollten das Land zerstören, erzählt er. Ein Mittel sei die Öffnung der Grenzen. Mittlerweile seien 20 Millionen illegale Einwanderer im Land. Trumps Versprechen, sehr viele abzuschieben, begrüßt er: „Bring it on“, sagt er. Legale Migration sei ja in Ordnung, aber die Leute müssten die Sprache lernen und was es heiße, Amerikaner zu sein.
Außerdem könne man ganz einfach gegen illegale Migration vorgehen. Man müsse nur den Ländern, aus denen die Migranten kommen, genügend Geld geben, damit sie sich selbst helfen können und die Bürger keinen Grund mehr hätten, von dort zu fliehen. Das funktioniere aber nicht, da es „Kontrolleure“ gebe – die er nicht näher bezeichnet –, die wollten, dass es arme und reiche Länder gebe, damit sie selbst Profite machen könnten.

Das Endziel der Demokraten sei klar: die Einführung des Kommunismus in Amerika. Jeder solle überwacht werden, am besten lückenlos mit elektronischen Mitteln. Deshalb fördere die Regierung auch den Verkauf elektronischer Autos. Jeglicher Widerstand solle sofort erkannt und unterdrückt werden: „Du hast etwas gesagt, das uns nicht passt: Eine Woche kein Essen für dich“, beschreibt er diese Dystopie. Den Einwand, dass das nach einer Diktatur klinge und nicht unbedingt nach Kommunismus, wischt er beiseite: „Das ist für mich dasselbe.“
Warnung vor Wahlbetrug
Auch dass von einer solchen Technodiktatur einer der bekanntesten Trump-Unterstützer, der Tesla-Inhaber Elon Musk, profitieren würde, ficht ihn nicht an. Dem und anderen Trump-Freunden aus der Techbranche liege das Wohl der Menschheit am Herzen. „Wenn Musk nicht Twitter gekauft hätte, gäbe es heute keine freie Meinungsäußerung mehr in diesem Land“, zeigt er sich dem Milliardär dankbar. Anderen Großverdienern ist er weniger zugeneigt: „Konzerne, die große Gewinne einstreichen, müssen zerschlagen werden. Die Macht muss in die Hände der Leute“, sagt er.
Mit Blick auf die Präsidentenwahl im November ist er zuversichtlich. Sehr viele Schwarze und Latinos werden für Trump stimmen, ist er überzeugt, „das sehe ich überall in den sozialen Medien“. Trump werde „einen Erdrutschsieg erringen. Auch wenn es wieder Versuche geben wird, die Wahl zu stehlen, so wie vor vier Jahren“, sagt Scott. Maricopa County – der Bezirk mit der Hauptstadt Phoenix – sei immer republikanisch gewesen. Es sei unmöglich, dass der plötzlich an die Demokraten gehen sollte. Auch die Gouverneurswahl 2022 sei manipuliert worden. Die jetzige Gouverneurin, die Demokratin Katie Hobbs, habe in ihrer damaligen Funktion ihre eigene Wahl überwacht, sagt er und impliziert Betrug.
Scott wird unterbrochen von Kunden, die ein Foto von sich mit einem Pappaufsteller von Donald und Melania Trump machen wollen. Das komme immer wieder vor, erzählt Scott. Die Leute seien sehr dankbar dafür, dass es den Laden gebe. Eine Frau habe sich bei ihm bedankt und geweint. „Ich tue Gottes Werk“, sagt er.