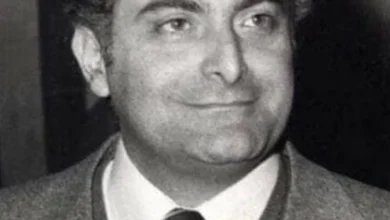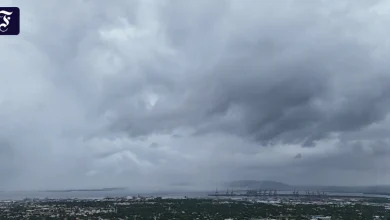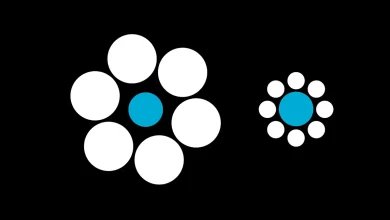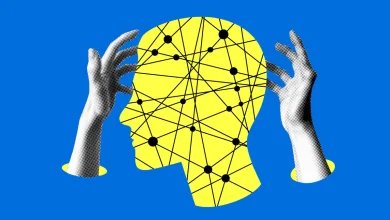Artenvielfalt: Warum sich manche Pflanzen nur durch Einfrieren retten lassen | ABC-Z

Das kann auch nur Holländern passieren: Als der Botaniker Jan Wolf vor vierzig Jahren gemeinsam mit dem freiwilligen Helfer Jan Klomp im kolumbianischen Regenwald nach neuen Pflanzenarten suchte, muss er innerlich die Augen verdreht haben. Denn sein botanisch völlig ungebildeter Helfer stellte eine lustige Fehldiagnose.
Was war passiert? Klomp war wegen seiner guten Kletterkünste mit in den Regenwald gekommen, die sind bei der Suche nach unbekannten Epiphyten Gold wert. Also erklomm er mit seinem Klettergeschirr in einem kleinen, von Kaffeeplantagen umgebenen Regenwaldstück einen Baum und rief zu seinem Forscherkollegen hinab, er habe einen Tulpenbaum entdeckt. Wolf, der sich mit Pflanzen auskannte, wusste natürlich, dass das nicht sein konnte: Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Tulpen liegt in Afrika, Asien und Europa. Und Tulpenbäume gibt es schon gar nicht. Also sucht er am Boden nach Blüten, um herauszufinden, was Klomp wohl entdeckt haben mochte. Er fand verholzte Früchte – die ohne Zweifel zur Familie der Magnoliengewächse gehört. Der Rest des Baumes aber war Wolf unbekannt. Die beiden Forscher hatten zwar keine Riesentulpe, aber eine bis dahin unbekannte Magnolienart entdeckt: Magnolia wolfii.
40 Jahre ist das nun her – und seither wurden nur sechs weitere dieser Magnolienbäume entdeckt, die Art gilt als stark gefährdet. Beim Blick in deutsche Vorgärten, wo Magnolien im Frühjahr mit aller Kraft den Winter vertreiben, würde man wohl nicht vermuten, dass diese Art damit das Schicksal fast aller dreihundert bekannten Magnolienarten teilt: Sie sind bedroht oder stark bedroht, ihr Dasein auf der Erde scheint absehbar endlich.
Das geht auch vielen anderen Pflanzenarten so. Deshalb setzen sich Wissenschaftler seit mehr als einem Jahrhundert dafür ein, sie zu konservieren. Sie werden in Gewächshäusern, botanischen Gärten kultiviert. Viele landen auch in Samenbanken, die erste wurde 1920 in der Sowjetunion gegründet, die heute berühmteste und weltweit größte ist mit 1,3 Millionen Samen von fast 6300 Arten der Saatgutspeicher auf Spitzbergen. In diesen Speichern werden Samen verschiedener Pflanzen bei Temperaturen von etwa minus 18 Grad Celsius eingelagert und so in einen künstlichen Winterschlaf versetzt. Alle paar Jahren werden sie wieder hervorgeholt und zum Keimen gebracht – um sicherzustellen, dass sie nicht endgültig eingeschlafen sind.
Vor allem Nutzpflanzen und ihre wilden Verwandten werden so konserviert – um im Falle der Fälle ein Genreservoir gegen Krankheitserreger oder Wetterextreme zur Hand zu haben.
Doch für Magnolien kommt ein solcher Weg nicht infrage, ihre Samen lassen sich nicht auf die herkömmliche Art haltbar machen. Also versuchen Wissenschaftler es mit Kryokonservierung: Sie entziehen Gewebeproben Wasser und frieren es mit flüssigem Stickstoff bei knapp minus 200 Grad Celsius tief. Ähnlich wie es in San Diego einen Frozen Zoo für Gewebeproben aussterbender oder ausgestorbener Tierarten gibt (dort lagern beispielsweise auch Hautzellen von zwölf Nördlichen Breitmaulnashörnern, von denen es nur noch zwei lebendige Exemplare auf der Welt gibt), gibt es also auch Frozen Greenhouses.
Allerdings werden fast nur Nutzpflanzen kryokonserviert: in Peru 4086 tiefgefrorene Proben von Kartoffelpflanzen, in Belgien 1258 Bananensorten, in Südkorea 1158 Knoblauchvariationen, auch eine Avocadobank gibt es. Gefährdete Pflanzen wie Magnolien finden bisher, wenn überhaupt, nur in botanischen Gärten eine Zuflucht.